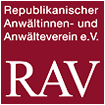Der Westberliner Sobibor-Prozess 1949/1950
UNGEHEURE NS-VERBRECHEN VOR EINER AHNDUNGS- UND VERURTEILUNGSWILLIGEN JUSTIZ
Dagi Knellessen
»Heute, gegen 19.30 Uhr, erkannte ich im Viktoriapark Berlin SW 29, einen Oberscharführer des KZ Sobibor wieder…«
Am Samstag, den 30. Juli 1949 ereignete sich in Westberlin eine skurrile, doch für die damalige Zeit nicht ganz ungewöhnliche Begegnung. Der polnische Jude und Sobibor-Überlebende Samuel Lerer (geb. 1922 in Żółkiewka/Polen, gest. 2016 in New York/USA) erkannte auf einer Kirmes im Viktoriapark in Kreuzberg den einstigen SS-Oberscharführer
Erich Bauer, der unter den Häftlingen als der ›Gasmann‹ bekannt war. Lerer – der fließend Deutsch sprach – erstattete auf der nahegelegenen Polizeiwache in der Friesenstraße Anzeige. Hier gab er an: Seine Angehörigen wurden durch Bauer selbst vergast, er sei im KZ ausschließlich mit »Vergasungsarbeiten betraut« gewesen. Zudem wäre er unter den Häftlingen als Sadist bekannt gewesen; er habe laufend Grausamkeiten an seinen »jüdischen Glaubensgenossen« und ihm selbst begangen. Als weitere Zeugin, die in Berlin lebe, benannte er die ebenfalls polnische Jüdin und Sobibor-Überlebende Estera Raab (geb. 1922 in Chełm, gest. 2015 in Vineland, New Jersey/USA). Der Polizeibeamte in der Friesenwache nahm die Aussage von diesem ungeheuren Mordverbrechen in einem völlig unbekannten NS-Vernichtungslager im Osten Polens(1) in einem knapp einseitigen Protokoll auf und handelte sofort. Da Lerer die vollständige Adresse Bauers – einige Straßen weiter in der Riemannstraße – angegeben hatte, wurde dieser gegen 22 Uhr in seiner Wohnung festgenommen und auf der Wache vernommen. Bauer bestritt sämtliche Vorwürfe »auf das Entschiedenste«, alle Angaben Lerers wären eine »glatte Lüge«. Im SS-Kommando Sobibor sei er als Kraftfahrer eingesetzt gewesen, er habe ausschließlich Verpflegung und Material transportiert. Mit den Häftlingen sei er kaum in Kontakt gekommen. Von den Vergasungen habe er nur vom »Hörensagen« gewusst, »diesen extra abgeschlossenen Komplex« habe er nie betreten. Der Haftrichter ordnete dennoch in derselben Nacht Untersuchungshaft an, da der dringende Verdacht des Verbrechens gegen die Menschlichkeit bestand, der von dem Zeugen hinreichend bekräftigt worden sei. Angesichts der schweren Tatvorwürfe hielt der Richter die Anwendung des Alliierten Kontrollratsgesetzes Nr. 10 (KRG 10) für angebracht, das in Westberlin im Fall von NS-Verbrechen noch bis Juli 1952 von deutschen Gerichten angewendet werden konnte.
Am folgenden Tag, dem 1. August 1949, machte Estera Raab eine umfassende Aussage. Auch sie gab an, dass Bauer die Vergasungsanlage in Sobibor bedient habe; zudem wäre er an vorbereitenden Vorgängen zum Massenmord beteiligt gewesen. Sie warf ihm außerdem anhand konkreter Ereignisse vor, eigenmächtig Häftlinge erschossen und erschlagen zu haben, teils mit anderen SS-Männern, die sie namentlich nannte. Die Staatsanwaltschaft ermittelte zügig, nahm politisch unvoreingenommen Kontakt mit der polnischen Militärkommission auf, die einen Auszug aus dem Bericht der ›Polish Charges against German War Criminals‹ zum Vernichtungslager Sobibor zusandte. Dieses Dokument blieb das einzig Schriftstück, das die Existenz des Vernichtungslagers Sobibor bestätigte.
›VERBRECHEN GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT‹
Mitte Oktober 1949 erfuhren die Berliner Ermittler, dass in Frankfurt/Main ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen die in Sobibor eingesetzten SS-Angehörigen Hubert Gomerski und Johann Klier angelaufen war.(2) Hier waren drei weitere polnisch-jüdische Zeugen aufgetaucht, die wie Lerer und Raab mit dem Status als Displaced Persons (DPs) in Deutschland lebten: Hersz Cukierman (geb. 1893 in Kurów/Polen, gest. 1979 in New Jersey/USA) und sein Sohn Josef (geb. 1930 in Kurów/Polen, gest. 1963 in Deutschland), die in Stuttgart bzw. Umgebung lebten sowie Fiszel Bialowicz (geb. 1929 in Izbica/Polen, gest. 2016 in Florida/USA), der im jüdischen DP-Camp Landsberg/Lech untergebracht war. Alle drei hatten sich auf einen Aufruf der Interessensvertretung jüdischer DPs, dem Central Committee of the Liberated Jews in the American Occupied Zone in Germany gemeldet. Alle standen kurz vor ihrer Ausreise in die USA.
Die Berliner Untersuchungsrichterin, die die gerichtliche Voruntersuchung gerade eröffnet hatte, hielt alle Beteiligten der Justiz an, die Verfahren nochmals zu beschleunigen, da wichtige Belastungszeugen Deutschland bald verlassen würden. Anfang Februar 1950 schloss die Richterin die Voruntersuchung ab. Mitte März reichte der Generalstaatsanwalt beim Landgericht die knapp gehaltene, sechsseitige Anklageschrift ein, nachdem der amerikanische Hohe Kommissar im Fall Bauer die Anwendung des KRG 10 genehmigt hatte. Erich Bauer wurde angeklagt »in der Zeit von März 1942 bis November 1943 fortgesetzt handelnd Gefangene des früheren Konzentrationslagers Sobibor/Polen aus politischen und rassischen Gründen verfolgt und dadurch gegen die Menschlichkeit verstoßen zu haben«. Konkret wurde dem Angeschuldigten vorgeworfen: Seine Beteiligung am Ausladen der Deportierten. Das Treiben der Jüdinnen und Juden durch den sogenannten Schlauch zu den Gaskammern. Seine Funktion als Gasmeister, wodurch er maßgeblich an der Vergasung beteiligt war. Außerhalb des Vernichtungsvorgangs wurden ihm zahlreiche Fälle von Misshandlungen und Erschießungen von Häftlingen zur Last gelegt. Als einzige Beweismittel waren die Aussagen der fünf Sobibor-Überlebenden aufgeführt.
Am symbolischen Datum, dem 8. Mai 1950, eröffnete der Vorsitzende Richter Alfred Levy (geb. 1887 in Birnbaum, gest. 1959) vor einem gut gefüllten Saal die Hauptverhandlung gegen Erich Bauer vor dem Schwurgericht am Landgericht Berlin. Die Staatsanwaltschaft war durch Hans-Alfred Cantor (Jahrg. 1901) vertreten. Die Verteidigung Bauers hatte Rechtsanwalt Christian Weickert übernommen. Estera Raab und Samuel Lerer traten vor Gericht als Zeugen auf. Die Aussagen von Hersz Cukierman und Fiszel Bialowicz wurden verlesen, da sie mittlerweile in die USA übergesiedelt waren. Von Josef Cukierman, der noch in Deutschland war, lag ein Schreiben vor, das ebenfalls zu verlesen war. Als Zeugen der Verteidigung wurden Bauers Ehefrau sowie zwei weitere Frauen gehört, die mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert waren. Alle drei bekundeten, Bauer habe mehrfach erwähnt, dass er in Sobibor ausschließlich als Kraftfahrer eingesetzt war. Die Vernehmungen von Lerer und Raab, die den Hauptteil der Verhandlung ausmachten, ergaben ein dazu vollkommen gegensätzliches Bild. Beide schilderten, dass Bauer bei der Ankunft der Transporte immer auf der Rampe war. Dass er die nackten Jüdinnen und Juden prügelnd durch den sogenannten Schlauch getrieben hatte. Dass er als Gasmeister für die Vergasung direkt verantwortlich war und im Februar 1943 beim Besuch Heinrich Himmlers die Vergasung von 250 jüdischen jungen Frauen vorgeführt hatte. Außerhalb des Vernichtungsablaufs trugen sie sadistische Quälereien und Erschießungen von Häftlingen vor, die Bauer begangen hatte. Unter anderem die Erschießung von zwei jüdischen Jugendlichen, die ihm auf der Lagerstraße nicht schnell genug ausgewichen waren, durch Genickschuss. Die schwere Misshandlung des 14jährigen Jungen Max, der daraufhin als Arbeitsunfähiger ermordet worden war. Und wie Bauer wieder und wieder Hunde auf die Häftlinge hetzte.
»IMMER IN BLAUER SCHÜRZE…«
Beide Zeugen wurden vor allem dazu befragt, ob sie die Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. Im Fall der Einzelmorde und sadistischen Quälereien schilderten Lerer und Raab die genauen Tatumstände. Was Bauers Ruf im Lager anging, bezeugten beide, dass er der »Schrecken aller Häftlinge« war. Zu seiner Beteiligung am Vernichtungsablauf beschrieben sie, wie, wo und warum sie Bauer auf der Rampe und im Schlauch zur Gaskammer beobachten konnten. Bei dem zentralen Tatvorwurf, dass Bauer, der ›Gasmeister‹ war, endete jedoch ihre Augenzeugenschaft. Sie musste hier enden und zwar genau am Tor zu Lager III, da diesen hermetisch abgeschotteten Mordkomplex mit den Gaskammern keiner der Überlebenden je betreten hatte. Was Lerer allein bezeugen konnte, war, dass er Bauer über einen gewissen Zeitraum täglich ins Lager III gehen sah; am Vormittag hin, am Nachmittag zurück. Raab konnte beschreiben, von wo aus sie beobachtet hatte, wie Bauer nach der Ankunft eines Transports immer mit einer blauen Schürze bekleidet ins Lager III gegangen war; er wurde auch der ›Bademeister‹ genannt. Die Möglichkeit, dass noch ein anderer SS-Angehöriger in der Mordzone die Vergasung durchgeführt hatte, schlossen beide Zeugen aus: Nur Bauer war in Lager III. Er war der ›Gasmeister‹. Das hätten alle im Lager gewusst. Auf die erneute Nachfrage des Verteidigers Weickert antwortete Estera Raab: »Ich war im Lager zehn Monate. Die Besatzung war circa 30 Mann stark. SS-Leute. Außerdem waren [da] noch Ukrainer. Eine Hälfte bzw. ein Drittel war immer auf Urlaub. Wir wussten genau, wer welche Funktion hatte. Dann wurde von unseren jüdischen Jungens [den] Frauen die Haare vor dem Tod geschoren. Diese haben immer gesehen, wie Bauer immer mit der Schürze bzw. Arbeiterkittel einherging. Außer ihm ist kein anderer Scharführer hingegangen, wenn [ein] Transport kam. Begleitpersonal war wohl bei, aber mit Kittel nur Bauer«.
Der klein und schmächtig wirkende Angeklagte Bauer war laut der Presseberichte von Die neue Zeitung (NZ, 9.5.1950) und der Jüdischen Allgemeinen (J.A.,12.5.1950) geradezu zuversichtlich vor das Schwurgericht getreten, »als sei er sich des Ernstes der Situation überhaupt nicht bewusst« (NZ). Unbeeindruckt von den Aussagen der jüdischen Zeuginnen und Zeugen stritt er die Tatvorwürfe ab und beharrte darauf, dass er ausschließlich Lebensmittel gefahren und nur durch das Gerede im Lager von den Vergasungen erfahren habe. Ein Zugeständnis machte er letztendlich doch. Wenn niemand anders da gewesen sei, habe er die Deportierten zur Vergasung begleitet und sie dabei etwas angetrieben: »Ich habe lediglich einzelne Häftlinge mit dem Stock angestoßen, um sie zu bewegen, schneller zu gehen. Wenn die Frauen – man weiß ja, wie Frauen sind – sich so am Stacheldraht festhielten, dann habe ich gesagt, nu kommen Se mal und bleiben Se hier nicht stehen« (NZ).
ALLIIERTES KONTROLLRATSGESETZ IN ANWENDUNG
Die Beweisaufnahme wurde noch am selben Tag geschlossen. Oberstaatsanwalt Cantor plädierte im Anschluss auf Todesstrafe. Die Verhandlung habe eine Reihe bestialischer Verbrechen Bauers bewiesen, mit denen er »nicht nur die Individuen, sondern die Menschlichkeit verletzte, in einem Maße, das nur durch die schwerste Strafe zu sühnen ist« (J.A.). Selbst Verteidiger Weickert schätzte offensichtlich die Beweislast erdrückend ein und beantragte schlicht »eine gerechte Strafe«. Bauer selbst äußerte sich nicht mehr.
Nach einem knapp neunstündigen Verhandlungstag sprach Richter Levy das Urteil: Erich Bauer wurde »wegen fortgesetzten Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt«. Die drei Richter und die sechs Schöffen waren den Aussagen der Hauptbelastungszeugen Lerer und Raab in fast allen Punkten gefolgt. Auch den schwersten Tatvorwurf, dass Bauer die Vergasungsanlage bedient hatte, sah das Schwurgericht als erwiesen an. Bauers Beweggründe und seine Intention, die Verbrechen zu begehen, ordneten die Richter seiner eigenen inneren Haltung zu; eine Notstandslage war in seinem Fall nicht erkennbar. Nicht das verbrecherische NS-Regime, noch sogenannte Haupttäter, sondern Bauer allein war für sein Handeln verantwortlich: »Der Angeklagte hat die Häftlinge aus ›politischen, rassischen und religiösen Motiven‹ verfolgt. Im Schutze des nationalsozialistischen Systems, das seine Taten guthieß, hat er das rechtslose Willkürregiment dazu benutzt, diese andersrassigen, andersgläubigen und politisch anders denkenden Menschen ungestraft zu schikanieren, zu misshandeln und zu vernichten«. Die schriftliche Urteilsbegründung ist insgesamt von dem menschenrechtlichen und am Gerechtigkeitsanspruch der Opfer orientierte Grundgedanken des Alliierten Kontrollratsgesetztes Nr.10 durchzogen. Die Richter waren dieser Linie den gesamten Prozess über gefolgt und fällten letztendlich konsequent das erste Todesurteil wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Westberlin. Wenig später erfolgte die Umwandlung in lebenslange Haft, da die Todesstrafe mit dem Grundgesetz nicht vereinbar war.
In diesem für die juristische Aufarbeitungsgeschichte der NS-Verbrechen außergewöhnlichen ersten Sobibor-Verfahren kurz nach der Gründung der beiden Nachfolgestaaten spiegeln sich in vielfacher Weise die zeitgenössischen Verhältnisse in Westberlin wieder. Die zeitliche Nähe zu dem Mordgeschehen in dem reinen NS-Vernichtungslager Sobibor, von dem die fünf jüdischen Überlebenden berichteten, löste ganz offensichtlich bei den Polizei- und Justizbeamten keine Abwehrreflexe, sondern einen immensen Ahndungsdruck aus. Zudem personifizierten die polnischen Juden, die als staatenlose DPs noch in Deutschland lebten, die dramatischen Umstände der Katastrophe, die hinter ihnen lag. Samuel Lerer, Estera Raab, Fiszel Bialowicz sowie Hersz und Josef Cukierman gehörten zu den circa sechzig Überlebenden des Vernichtungslagers Sobibor. Sie alle waren dem Lager durch den Aufstand der Häftlinge am 14. Oktober 1943 entkommen und hatten die weiterhin lebensbedrohliche Zeit bis zum Kriegsende überstanden. Die SS hatte bis Ende 1943 den gesamten Lagerkomplex vollständig demontiert und nahezu sämtliche Dokumente vernichtet. Nach der Ermordung von circa 250.000 Jüdinnen und Juden sollte das Verbrechen ausgelöscht werden, als hätten weder die Menschen noch der Massenmord je existiert. Die sechzig Überlebenden des Lagers waren damit die einzigen nicht-tatbeteiligten Zeugen, die für die nachfolgenden NS-Prozesse überhaupt zur Verfügung standen. Noch im Jahre 1945 waren fast alle Sobibor-Überlebenden Teil der großen Wanderungsbewegung von überwiegend polnischen Jüdinnen und Juden, die vor der antisemitischen Pogromstimmung im Nachkriegspolen Richtung Westen flohen. Für sie wie für die meisten der circa 150.000 bis 200.000 staatenlosen jüdischen Displaced Persons war Deutschland ein Zwischenstopp auf der Weiterreise zumeist nach Palästina bzw. ab 1948 nach Israel oder in die USA.
RÜCKKEHR DER BRAUNEN JURISTEN
Die befristete Präsenz der fünf jüdischen Zeuginnen und Zeugen trieb in Westberlin nicht nur das Verfahren massiv voran, sie hatten darüber hinaus insgesamt einen außergewöhnlich hohen Stellenwert; dies gilt vor allem für die beiden Hauptbelastungszeugen Estera Raab und Samuel Lerer. Durch ihre Anzeige wurden die Ermittlungen ausgelöst, ihre Aussagen waren Grundlage der Anklageschrift, und das Verhandlungsgeschehen wurde von ihren Vernehmungen bestimmt. Im Urteil bezog sich das Schwurgericht in nahezu vollem Umfang auf die Aussagen der jüdischen Zeuginnen und Zeugen und sah »die Einlassungen des Angeklagten als widerlegt an«. Als wesentliches Indiz ihrer Glaubwürdigkeit führten die Richter an, dass »die Zeugen sich offensichtlich bemüht haben, trotz der Schwere der in Sobibor durchgemachten Leiden und trotz des Verlustes naher Angehöriger in diesem Lager, den viele von ihnen zu beklagen hatten, ihre Aussagen ruhig und ohne Hass zu machen«. Die Haltung gegenüber den Überlebenden dieses Verbrechens und die dringliche Dynamik, die zusammen das Verfahren bestimmt hatten, erklärt ein Blick auf die Zusammensetzung der Justizangehörigen. In den entscheidenden Positionen befanden sich entweder deutsche Juden oder Juristen, die während der NS-Zeit selbst aus dem Justizdienst ausgeschieden waren. So saß der Hauptverhandlung der deutsch-jüdische Jurist Alfred Levy vor. Er hatte in Königsberg dem in der Weimarer Republik gegründeten Republikanischen Richterverein angehört und war engagierter Sozialdemokrat; 1938 nach den Novemberpogromen wurde er für drei Monate in Sachsenhausen interniert. Die Zeit bis 1945 überstand er durch die ›Mischehe‹ mit seiner ›arischen‹ Frau. Oberstaatsanwalt Hans-Alfred Cantor, der wegen seines jüdischen Vaters als ›Halbjude‹ galt, musste Zwangsarbeit bei der Organisation Todt leisten. Sein Vater nahm sich 1944 in einer völlig ausweglosen Situation das Leben. Beide Juristen schienen sicher zu sein, dass ihre eigene NS-Verfolgungsgeschichte kein Hindernis war, das NS-Verbrechen in Sobibor aufzuklären bzw. darüber zu richten. Selbst wenn sich Widerstände innerhalb der Strafverfolgungsbehörde bzw. der Richterschaft regten, wussten sie, dass sich in ihrem engeren und weiteren Umfeld und dem politischen Klima der geteilten Stadt, die Dominanz von NS-belasteten Juristen und ein von manischen Schuldabwehrreflexen beherrschtes Klima noch nicht durchgesetzt hatten. Noch war der deutsch-jüdische Jurist Dr. Richard Preuss Oberstaatsanwalt am Landgericht. Noch besetzte Richard Neumann, der Theresienstadt überlebt hatte, den Posten des Generalstaatsanwalts am Kammergericht. Noch wies das Landgericht den Antrag Erich Bauers, Richter Levy wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen mit folgender Begründung souverän zurück: »Die Zugehörigkeit eines Richters zu einem politischen Verein, zu einem bestimmten Religionsbekenntnis oder zu einem bestimmten Volksstamm, z.B. dem jüdischen, reicht für sich allein nicht aus, um das Misstrauen eines Angeklagten gegen die Unparteilichkeit des Richters zu rechtfertigen, es sei denn, dass noch andere Tatsachen geltend gemacht werden. Solche sind aber weder vorgebracht noch aus den Akten ersichtlich«. Und noch wurde nicht zuletzt Westberlin von dem linken Sozialdemokraten und Remigranten Ernst Reuter regiert. Der Verlauf des Sobibor-Verfahrens war kein Einzelfall im Westteil der Stadt. Vielmehr weisen noch einige andere ähnlich geführte NS-Prozesse darauf hin, dass in relevanten Teilen der Westberliner Justiz der 1949/1950er-Jahre durchaus der Wille vorhanden war, die NS-Verbrechen konsequent zu ahnden und zu verurteilen. Nichtsdestotrotz geht es um eine kurze Phase, in der die Macht- und Mehrheitsverhältnisse noch nicht ausgemacht waren. Schon 1951 kehrten mit der Wiedereinstellung der sogenannten ›131er‹ die braunen Juristen unaufhaltsam in den Justizapparat zurück.(3) Ab Mitte 1952 wurde das Alliierte Kontrollratsgesetz Nr. 10 von Westberliner Gerichten nicht mehr angewandt; in West-Deutschland bereits ab 1951. Die Wende in der Justiz war vollzogen. Von nun an zeichnete sich bundesweit bis zum Ende der 1950er-Jahre die Ahndung von NS-Verbrechen durch Verschleppungen und eine absurd milde Urteilspraxis aus.
Die jüdischen Überlebenden waren in den folgenden drei Sobibor-Prozessen in den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren mit einer geradezu gegensätzlichen Grundhaltung der deutschen Justiz konfrontiert. Ihre exponierte aus dem NS-Verbrechen resultierende Position, dass sie die einzigen Zeugen eines nahezu spurenlosen Verbrechens waren, wendete sich mit jedem Jahrzehnt ein Stück mehr gegen sie. Jenseits der scharfen, teils auch klar antisemitisch motivierten Attacken der Verteidiger, zogen die Richter den Beweiswert ihrer Aussagen zunehmend in Zweifel. Zudem lösten sie die juristische Differenzierung zwischen der Glaubwürdigkeit der Person und der Glaubhaftigkeit ihrer Aussage in den Urteilen mehr und mehr auf. Im Urteil, das 1985 im Wiederaufnahmeverfahren Karl Frenzel gefällt wurde, hatten die Richter des Landgerichts Hagen letztendlich die Aussagen der meisten Sobibor-Überlebenden und ihre Person in Gänze demontiert.
Die Erziehungswissenschaftlerin Dagi Knellessen arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, Leipzig an dem Forschungsprojekt ›Paradoxien der Zeugenschaft. Jüdische Überlebende in bundesdeutschen Sobibor-Prozessen, 1949-1989‹.
Die Zitate aus den Gerichtsakten wurden zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit nicht im Einzelnen ausgewiesen. Die Akten des Verfahrens Pks 3/50 gegen Erich Bauer in Westberlin sind im Landesarchiv zugänglich und unter der Signatur LA Berlin, B Rep. 058 einsehbar. Die Rechtschreibung in den Aktenzitaten wurde von der Redaktion an die gegenwärtig gültigen Regeln angepasst, ebenso die (Zwischen)Überschriften eingefügt.
Fußnoten
(1) Sobibor, Treblinka und Belzec waren drei NS-Vernichtungslager der sogenannten ›Aktion Reinhard‹. Die systematische SS-Vernichtungsaktion zur Ermordung sämtlicher Jüdinnen und Juden erstreckte sich auf die fünf Distrikte des Generalgouvernements (Warschau, Lublin, Radom, Krakau und Lemberg). Von März 1942 bis Oktober 1943 wurden in den drei Vernichtungslagern fast zwei Millionen überwiegend polnische Jüdinnen und Juden sowie 50.000 Roma und Sinti ermordet. In Sobibor wurden mindestens 250.000 Menschen umgebracht, in Belzec 600.000 und in Treblinka mehr als 900.000. Am 2. August 1943 brach in Treblinka ein Massenaufstand der Häftlinge aus, wodurch um die 70 jüdische Häftlinge überlebten. Am 14. Oktober 1943 setzte in Sobibor die Revolte der Häftlinge ein, circa 300 konnten fliehen, von denen wiederum nur 60 bis zum Kriegsende überlebten. In Belzec, wo es keinen Aufstand gab, überlebten fünf Häftlinge das Lager.
(2) Das parallel laufende Frankfurter Sobibor-Verfahren wurde Mitte März 1949 durch ein Schreiben des tschechisch-jüdischen Sobibor-Überlebenden Kurt M. Thomas, früher Kurt Ticho (geb. 1914 in Brno/Tschechoslowakei, gest. 2009 in Columbus, Ohio/USA) ausgelöst, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits in den USA niedergelassen hatte. Der im August 1950 vor dem Landgericht Frankfurt/Main geführte Prozess gegen die ehemaligen Angehörigen der Lager-SS von Sobibor, Hubert Gomerski und Johann Klier, wurde auf der Grundlage des deutschen Strafrechts geführt. Beide waren wegen Mordes, Beihilfe zum Mord und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Im Fall Gomerskis kam das Frankfurter Gericht im Grunde zu demselben Urteil wie die Berliner Richter. Er wurde als Mittäter für jeden Fall des Mordes nach § 211 StGB zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Johann Klier, den alle jüdischen Zeugen entlastet hatten, sprach das Gericht frei.
(3) Im April 1951 verabschiedete der Bundestag nach kontroversen Diskussionen das ›Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen‹. Das sogenannte ›131er-Gesetz‹ schuf eine Rechtsgrundlage, die Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die durch Wehrdienst, Vertreibung oder Entnazifizierung ihre Anstellung verloren hatten, einen Anspruch auf Wiedereinstellung und Versorgung garantierte. Damit war die Wiedereinstellung von fast allen Beamtinnen und Beamten des NS-Staates gesetzlich verankert.