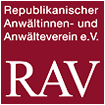Zwischen Schutz und Maskerade - Kritik(en) des Rechts
Sonja Buckel
Das Verhältnis radikaler Gesellschaftskritik zum Recht ist bestenfalls als ambivalent zu bezeichnen. Dessen enge Verbindung zum Staat, seine Normativität, die Absicherung von Eigentumsverhältnissen, der scheinbar ideologische Gehalt der Menschrechte - all das erzeugt zumindest einen Anfangsverdacht gegenüber dem Recht. Gleichzeitig ist kaum eine soziale Bewegung bekannt, die nicht auch Rechtsforderungen aus sich heraus erzeugt hätte. Insofern trifft Ingeborg Maus durchaus den Kern, wenn sie leicht ironisch zur Frankfurter Schule anmerkt (Maus 1995: 511), dass das Recht vielleicht ein »noch vertrackteres Ding als die Ware« sei. So hatte etwa Adorno (1994: 304) das Gehege von Systematisierung, welches die Subsumtion des je Besonderen unter juridische Kategorien organisiere, als das »Urphänomen irrationaler Rationalität« bezeichnet (zur Kritik siehe Bung 2007).
Feministische Rechtstheorie weist ein kaum weniger kompliziertes Verhältnis zum Recht auf (Kiss 1995). Susanne Baer hat den ambivalenten Umgang mit dem Recht deswegen geradezu als ›feministisches Dilemma‹ bezeichnet (Baer 1998: 236). Der Kampf um Rechte verstricke sich notwendig in »Rechtsparadoxien «, so dass man bestenfalls darüber sagen könne, sie seien dasjenige, »which we cannot not want« (Brown 2000). Während normative Ansätze mit dem Recht eine zivilisatorische Errungenschaft feiern, ein gewisses Potential von Solidarität und die Eindämmung von Gewalt, gilt denjenigen, welche die gesellschaftlichen Verhältnisse als vermachtete und verwaltete Welt kritisieren und ihre grundlegende Transformation anstreben, genau jene Vorstellung als geradezu naive und oberflächliche Betrachtungsweise. Obwohl die Verstrickung des Rechts in die Aufrechterhaltung bestehender Herrschaftsverhältnisse als sicher gilt, wählen soziale Bewegungen kontinuierlich rechtliche Strategien, etwa Klagen gegen Studiengebühren, gegen die Einschränkung der Demonstrations- oder Reisefreiheit oder als Schutz individueller Freiheiten vor staatlicher Willkür.
Der ambivalente Zugang gesellschaftskritischer Bewegungen zum Recht, so die hier vertretene These, ist kein Zufall, kein bloß unentschlossenes Oszillieren, sondern liegt im Phänomen des Rechts selbst begründet: In seiner widersprüchlichen Grundstruktur. Um dieser auf die Spur zu kommen, werde ich zunächst fünf klassische Kritiken des Rechts vorstellen, wie sie sowohl von feministischen und marxistischen als auch postmodernen oder queeren Rechtstheorien vertreten werden. Daran anschließend werde ich vor dem Hintergrund dieser Kritiken eine materialistische Analyse eben jener Grundstruktur vorstellen, um schließlich zu fragen, welchen möglichen Umgang gesellschaftskritische Bewegungen mit dem Recht pflegen können, um aus der ambivalenten Haltung herauszufinden.
1. Kritiken des Rechts
Absicherung des status quo
Otto Kirchheimer (1976/1930: 78) hat die wohl grundsätzlichste Kritik am modernen Recht auf den Punkt gebracht: Es sei die »Garantie einer bestehenden Gesellschaftsordnung«. Wie Kirchheimer ging auch der marxistische Jurist Franz Neumann davon aus (1980/1936: 246), dass Gesetze mit den Interessen der herrschenden Klassen korrespondieren. Das moderne Recht entspreche der Lebensweise der bürgerlichen Klasse, der Sicherung ihres Eigentums sowie ihrer privaten Autonomie, vor allem aber der Berechenbarkeit der Austauschprozesse einer warenproduzierenden Konkurrenzökonomie.
Feministinnen argumentieren ähnlich, auch wenn das fokussierte Herrschaftsverhältnis ein anderes ist: Recht entspreche der patriarchalen Lebensweise. Catherine MacKinnon, die einflussreichste Vertreterin der radikal- feministischen Rechtstheorie, vertritt die Ansicht, dass die Klasse der Männer den Rechtsdiskurs so lange geprägt habe, dass er die Realität von Frauen komplett ignoriere. Sowohl geschlechtsneutrale als auch spezielle rechtliche Schutznormen für Frauen reproduzierten immer erneut die ungleiche Machtverteilung, denn »masculinity, or maleness, is the referent for both« (MacKinnon 1993/1987: 278). Recht sei deswegen taub für das Kernanliegen von Feministinnen, argumentiert die postmoderne Rechtstheoretikerin Carol Smart (1989: 2). Diese sollten daher skeptisch gegenüber dem Recht sein. Es sei ein ›phallogozentrischer Diskurs', in dem sich ein maskulinistischer, heterosexueller Imperativ mit der Disqualifizierung des Wissens und der Erfahrung von Frauen überlappe. Recht werde konstituiert als eine männliche Profession, nicht nur weil Frauen disproportional selten in den höchsten rechtlichen Institutionen vertreten seien, sondern vor allem deswegen, weil der ganze Corpus des Rechts um ein Serie von sexualisierten, hierarchisierten Dualismen herum strukturiert sei. Männlichkeit werde dabei mit der einen Seite, der des Recht, identifiziert: Rationalität, Vernunft, Macht, Objektivität (ebd. 86): »Put simply, in order to have any impact on law one has to talk law's language, use legal methods, and accept legal procedures. All these are fundamentally anti-feminist or [...] bear no relationship to the concerns of women's lives.« (Ebd. 160 f.) Doch damit nicht genug. Hinzu kommt die regulatorische Macht des Rechts, worauf insbesondere Feministinnen in der Tradition Foucaults hinweisen. So produziere die Rechtsgewalt, was sie nur zu repräsentieren vorgebe (Butler 1991: 17). Selbst wenn also Frauen, sich spezifische Rechte als Schutzmechanismen gegen patriarchale Gewalt erkämpften, re-konstruierten spezielle Rechte von Frauen im selben Augenblick die Kategorie ›Frau‹ inklusive ihrer spezifischen Verletzlichkeit und ermöglichten damit ihre zukünftige Regulation als solche (Brown 2000: 232).
Nicht nur die bürgerliche und die patriarchale Lebensweise, sondern auch die heterosexuelle Matrix wird über das Recht abgesichert, so jedenfalls argumentieren AutorInnen einer queeren Rechtstheorie. Während diese den fiktionalen Status von ›sex‹, ›gender‹ und ›sexueller Orientierung‹ betont und die Unterscheidung von Homo- und Heterosexualität als historisch kontingent und unterdrückend ablehnt (Halley 2002: 82), vielmehr von multiplen Formen von Sexualität und Identitäten ausgeht, arbeite das Recht mit einem engen Verständnis, welches die geschlechtliche Binarität als Tatsache sowie Heterosexualität als Norm voraussetze (Elsuni 2007: 136). Der Rechtsdiskurs sei ein zentraler Ort für die Konstitution, Aufrechterhaltung und Regulation von Sexualität, vor allem der Hetero-Homo-Dichotomie. Er naturalisiere sexuelle Subjektivitäten, konstituiere sie als deviant oder normal und reguliere daran anschließend alles jenseits der Normalität (Stychin 1995: 7).
Recht ist also, folgt man diesen Kritiken, sowohl Ausdruck als auch Absicherung bestehender Herrschaftsverhältnisse, indem es die Lebensweise der jeweils dominanten Position innerhalb der Machthierarchie als universelle setzt.
Verhüllung/Maskerade
Neben der Absicherung des Warentausches ist die zweite Funktion des Rechts nach Neumann (1980/1936: 300) die der Verhüllung: »Das Gesetz verhüllt die wirkliche Herrschaft des Bürgertums, weil die Beschwörung der Gesetzesherrschaft es überflüssig macht, die tatsächlich Herrschenden in der Gesellschaft direkt zu bekennen.« Es ist nicht nur das Gesetz selbst, welches die dahinter stehenden Herrschaftsverhältnisse unsichtbar macht, sondern die gesamte Rechtstechnik. Dies ist insbesondere der Ansatzpunkt der US-amerikanischen Critical Legal Studies Bewegung (cls). Mit ihrer critique of indeterminacy bzw. der critique of adjudication zielen sie darauf ab, den grundsätzlichen Anspruch auf juristische Neutralität zu delegitimieren. Der Ausgang eines Rechtsfalles sei von Anfang an unbestimmt, die rechtliche Argumentation bloße Rhetorik: »The experience of manipulability is pervasive, and it seems obvious that whatever it is that decides the outcome, it is not the correct application of legal reasoning under a duty of interpretive fidelity to the materials.« (Kennedy 1997: 311) Rechtliche Doktrinen verschleierten diese grundlegende Unbestimmtheit, also ihre Imprägnierung durch die sozioökonomische Realität (Frankenberg 2006: 104). Sie seien insofern nichts anderes als ein ausgeklügeltes Vokabular und Repertoire manipulativer Techniken: »Law is simply politics dressed in different garb.« (Hutchinson / Monahan 1984: 206)
Weniger ideologiekritisch als machtanalytisch interpretiert Michel Foucault (1998/1976: 107 f) den skizzierten Effekt des Rechts als Repräsentationsweise der Macht im Recht: Die Gesetzesmacht sei mit dem Aufkommen des absolutistischen Staates entstanden. Das Recht spielte dabei die Rolle des Codes, in dem sich die Macht der abendländischen Gesellschaften seit dem Mittelalter präsentierte, in der sie reflektiert wurde (als Rechtstheorie) und in der sie seit dem modernen Rechtsstaat einzig als legitim angesehen wird. Das Recht ist demnach bis heute der offizielle Code der Macht, wohingegen die subtileren Technologien der Macht, die sich längst in seinen Nischen eingerichtet haben, gar nicht als solche erscheinen - so die klassische Argumentation Foucaults. Recht stabilisiert, zusammengefasst, bestehende Herrschaftsverhältnisse und invisibilisiert dies zugleich durch seine eigene Arbeitsweise.
Abstraktes Rechtssubjekt
Das abstrakte Rechtssubjekt ist der dritte Angriffspunkt radikaler Einwände. Die Reihe der KritikerInnen reicht von so unterschiedlichen AutorInnen, wie dem Rechtstheoretiker der Russischen Revolution Eugen Paschukanis bis hin zu poststrukturalistischen VertreterInnen wie Judith Butler. Letztere weist darauf hin, dass die Begrenzung der Rechtsprache »uns zwingt, Macht wieder in der Sprache der Rechtsverletzung zu lokalisieren, dieser Verletzung den Status einer Handlung zuzuschreiben und sie auf das Verhalten eines Subjekts zurückzuführen.« Das Gesetz lasse so das Subjekt wieder auferstehen und die komplexen institutionellen Strukturen unsichtbar werden (Butler 2006/1997: 125). Dabei produziere es die Vorstellung von einem Subjekt vor dem Gesetz als naturalisierte Grundannahme und verschleiere diese Produktion anschließend und damit die eigene regulierende Hegemonie (Butler 1991: 17).
Das auf diese Weise produzierte Subjekt sei, so Paschukanis, der Effekt der Warenproduktion: Indem sich die konkrete menschliche Arbeit in abstrakte verwandle, um die Bedürfnisbefriedigung mittels Warentausch zu ermöglichen, welche formal gleiche, freie, souveräne und mit eigenem Willen ausgestattete Subjekte voraussetze, »lösen sich alle konkreten Besonderheiten, die den einen Vertreter der Gattung homo sapiens von dem anderen unterscheiden, in der Abstraktion des Menschen überhaupt, des Menschen als juristischen Subjekts, auf.« (Paschukanis 1970/1924: 91)
Feministinnen hingegen erkennen in dem ontologisch autonomen, selbstgenügsamen und unbelasteten Subjekt einen spezifisch maskulinistischen Diskurs (Brown 2000: 239). Er transportiere die patriarchale Fiktion eines einheitlichen, separierten, Rechte innehabenden Einzelnen (Kiss 1995: 342). Das sei in dreierlei Weise problematisch: Es invisibilisiere (1.) durch seine formelle Gleichheit nicht nur die materielle Ungleichheit der vergeschlechtlichten Subjekte - was analog auch die marxistische Rechtstheorie herausgearbeitet hatte - sondern es transportiere zudem (2.) mit der Annahme der Autonomie und Autogenese des vorab gegebenen Subjekts eine immer schon männliche Phantasie. Psychoanalytisch betrachtet sei diese Autonomiekonzeption nichts anderes als die primäre Verdrängung der grundlegenden Abhängigkeit des Subjekts vom mütterlichen Prinzip (Butler 1993: 41). Die Abstraktion eines monolithischen Subjekts ist (3.) eine kapitalistisch-patriarchale Robinsonade, denn die Subjekte würden nicht als diskrete Einheiten fabriziert, sondern »various markings in subjects are created through different kinds of powers - not just different powers. That is, subjects of gender, class, nationality, race, sexuality and so forth.« (Brown 2000: 235)
Die Argumentation der Stabilisierung bestehender Herrschaftsverhältnisse sowie deren Maskerade taucht somit in der Kritik der juridischen Subjektkonstitution gebündelt wieder auf.
Anbindung an die Staatsgewalt
Die Kritiken des Rechts laufen in einer Argumentationsfigur zusammen, welche die Identität von Staat und Recht behauptet. In den 1930er Jahren war es Franz Neumann (1980/1936: 16), dessen Analysegegenstand der moderne Rechtsstaat war, der zunächst die materialistische Grundannahme entwickelte: Der moderne Staat sei die Verbindung von Souveränität und Freiheit, von Gewalt und Gesetz und diese beiden Elemente seien nicht miteinander zu versöhnen. Dies bedeute auch, dass das Recht durch beide geprägt sei: Es konstituiert eine normative Ordnung, die sich aber von moralischen oder sittlichen Normen durch ihren Erzwingungscharakter durch die Möglichkeit unterscheidet, staatliche Gewalt mobilisieren zu können (ebd. 28). Für Neumann, der insbesondere den Zerfall des Rechtsstaates in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus untersucht hatte, führte dies zur Konsequenz, sich auf die Seite des Rechts zu stellen und für seine Durchsetzung auch gegenüber der Staatsapparatur einzutreten.
Nicos Poulantzas teilte noch 40 Jahre später diese Perspektive, nicht jedoch ohne sie in markanter Weise zu verschieben. Denn der von Neumann dargestellte Gegensatz ist bei Poulantzas nicht nur unversöhnlich, sondern darüber hinaus illusionär: Das Recht sei nicht der Gegenpart zur unbeschränkten Macht, sondern integraler Bestandteil der repressiven Ordnung. Der Staat des Gesetzes, der im Gegensatz zu den vorkapitalistischen Staaten das höchste Gewalt- und Terrormonopol inne hat, »erlässt die Regel und verkündet das Gesetz und führt dadurch ein erstes Feld von Befehlen, Verboten und Zensur ein. Er schafft so das Anwendungsgebiet und den Gegenstand der Gewalt.« (Poulantzas 1978: 69) Dennoch wählte auch Poulantzas, in den Begriffen des »autoritären Etatismus« (vgl. hierzu Kannankulam 2008), wie Neumann die Strategie des Nachzeichnens eines Verlustes von Rechtsstaatlichkeit.
Poststrukturalistische KritikerInnen verwerfen das Einlassen auf das Recht grundsätzlicher. Am deutlichsten geschieht dies bei Giorgio Agamben (2002: 19), der einen Schritt weitergeht als Poulantzas: Die Gewalt ist nicht mehr nur die Kehrseite des Gesetzes, sondern der Ausnahmezustand das verborgene Fundament, auf dem das ganze politische System ruhe. Die souveräne Macht habe von Anfang an biopolitisch das ›nackte Leben‹ produziert, das heißt, den auf seine Körperlichkeit reduzierten Einzelnen, »so dass sich jeder Versuch, die politischen Freiheiten auf den Bürgerrechte zu gründen, als nichtig erweist.« (ebd. 190) (Menschen)rechte seien nicht das Andere des Staates, sondern schrieben vielmehr das ›nackte Leben‹ in den Staat ein (ebd.: 136). Auch wenn Judith Butler die Ausnahmestaatsthese nicht teilt, so verfolgt auch sie eine Argumentation der produktiven Macht des Staates: In dem Moment, da fortschrittliche soziale Bewegungen rechtliche Regulationen befürworteten, übersähen sie »die spezifische diskursive Macht, die an den Staat übergeht, wenn er mit Rechtsmitteln vorgehen kann.« Der Staat produziere aktiv die juridischen Kategorien und reguliere mit ihrer Hilfe die Einzelnen, insbesondere gesellschaftlich nicht hegemoniale Gruppen wie etwa Homosexuelle. Seine Kontrollmacht verstärke sich dadurch (Butler 2006/1997: 123). Die Praxis der Resignifizierung, das heißt, die wiederholende, verschiebende Aneignung von Diskursen, auf die Butler ansonsten politisch setzt, werde in rechtlichen Diskursen vom Staat okkupiert. »Der Staat resignifiziert immer und ausschließlich sein eigenes Gesetz, und diese Resignifizierung bedeutet eine Ausweitung seiner Jurisdiktion und seines Diskurses.« (ebd.: 160) Und dieser Diskurs ist ein Sprechen, das der Staat sanktioniert hat; Gerichtsurteile seien die sanktionierten Äußerungen des Staates, bzw. seines juridischen Zweigs (ebd. 155).
Eines der grundsätzlichen Probleme des Rechts aus einer gesellschaftskritischen Perspektive scheint demnach seine symbiotische Verbindung mit der Staatsgewalt zu sein. Das Gewaltmonopol des Staates wird dabei grundlegend als das das Recht definierende Merkmal konzipiert. Dies ist ganz offensichtlich gegen eine liberale Tradition verfasst, in der das Recht als pazifizierende Kraft thematisiert wird.
»Ethische Funktion«
Eine prinzipielle Ablehnung des Rechts wie bei Agamben ist allerdings selbst in den kritischen Ansätzen selten. Franz Neumanns Theorie liefert dafür das Paradebeispiel. So misst er dem allgemeinen Gesetz drei Funktionen zu, wobei die ersten beiden die bereits dargestellte Berechenbarkeit der kapitalistischen Warenproduktion und die Verhüllung der realen Machtverhältnisse darstellen. Die Dritte aber nennt er die »ethische Funktion« (1967/1937: 26) bzw. die »beschützende Funktion « (1980/1936: 246). Gemeint ist damit der Umstand, dass das Recht Sicherheit und ein gewisses Maß an Freiheit insbesondere durch die Unabhängigkeit des Richters und die Allgemeinheit des Gesetzes auch der ArbeiterInnenklasse garantiere (ebd. 311). Recht ermögliche zwar nur formale Freiheit und Gleichheit, aber dennoch besäße es das Potential, die ersten beiden Funktionen zu transzendieren. So sei historisch die »Rationalität des Rechts in hohem Maße den Armen und Arbeitern zugute « gekommen (1967/1937: 30).
Dieses Argument, der Schutz für die Schwächsten, findet sich ähnlich auch in der feministischen Rechtstheorie. Feministinnen, die Rechte ausschließlich wegen ihres abstrakten und individualistischen Charakters ablehnten, ignorierten die Tatsache, dass gerade Frauen diese Art von Rechten benötigten, argumentiert etwa Kiss (1995: 344). Verletzbare und stigmatisierte Gruppen profitierten am meisten von dem Schutz eines abstrakten und unpersönlichen Rahmens. Und auch Wendy Brown räumt ein (2000: 239), dass obwohl Rechte Verletzungen und Ungleichheiten stets erneut einschrieben, ohne die soziale Stratifizierung selbst zu hinterfragen, die Abwesenheit von Rechten diesen Zustand jedoch völlig intakt ließe.
Sarah Elsuni weist zudem darauf hin (2007: 139), dass der Rechtsdiskurs ein anerkanntes Vokabular biete, mit dem politische Missstände und soziale Ausschlüsse skandalisiert werden könnten. Es biete als argumentative Disziplin ein Forum, um alternative Perspektiven zu artikulieren, gerade für marginalisierte Lebensrealitäten und Erfahrungen.
2. Die widersprüchliche Arbeitsweise der Rechtsform
Die »ethische Funktion« des Rechts bleibt nicht nur bei Franz Neumann »ein seltsam fremdes, theoretisch unausgewiesenes Moment« (so Maus 1995: 509). Vielmehr zeigt sich an dieser Stelle die grundsätzliche Ambivalenz kritischer Auseinandersetzungen mit dem Recht. Wie kann es die bestehenden Herrschaftsverhältnisse reproduzieren und verhüllen und zugleich doch auch einen Schutzmechanismus für diejenigen bereitstellen, zu deren stets erneuter Unterdrückung es, im Zweifel unter Rückgriff auf das Gewaltmonopol, beiträgt?
Ich werde im Folgenden die Umrisse einer möglichen materialistischen Erklärung skizzieren, die auf einer Rekonstruktion der Erkenntnisse vor allem marxistischer Rechtstheoretiker beruht (für eine ausführliche Darstellung siehe Buckel 2007). Dabei lässt sich zeigen, dass die widersprüchlichen Bezugnahmen auf das Recht mit dessen widersprüchlicher Struktur zusammenhängen. Ist dies erst einmal erkannt, wird auch sichtbar werden, in welcher Weise progressive soziale Bewegungen rechtliche Strategien verfolgen können.
Subjektivierung und Kohäsion
Die Ausgangsthese lautet dabei, dass eine kritische Theorie das Recht als Ausdruck gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse konzipieren muss, die sich allerdings nicht einfach im Recht niederschlagen, sondern dabei mit seiner eigenen Logik konfrontiert werden. Es gilt demnach, die Spannung zwischen gesellschaftlichen Kämpfen und Herrschaftsverhältnissen (kapitalistischen, patriarchalen, heterosexistischen, rassistischen) einerseits sowie der spezifischen rechtlichen Arbeitsweise andererseits aufrechtzuerhalten und zu analysieren: Die Kämpfe um Hegemonie wie auch den Hegemonieeffekt (Foucault) selbst. Ich werde mit letzterem, der Rechtsform, beginnen, da sie den strukturierenden Rahmen vorgibt, innerhalb dessen hegemoniale Auseinandersetzungen im Recht stattfinden.
Recht in der kapitalistischen Produktionsweise nimmt den Charakter einer sozialen Form an, der Rechtsform. Soziale Formen sind die wesentlichen kapitalistischen Strukturprinzipien, die geronnenen gesellschaftlichen Verhältnisse, die das Handeln in einer nicht unmittelbar durchschaubaren Weise anleiten und grundlegende gesellschaftliche Widersprüche prozessierbar machen. Sie sind der Effekt einer Vergesellschaftung, in der sich gesellschaftliche Zusammenhänge gegenüber ihren ProduzentInnen verselbständigen und nur durch spezifische Träger gesellschaftlicher Synthesis herstellen können. Die Wertform ist die klassische soziale Form, in der sich nach Marx die Gesellschaftlichkeit der Arbeit im Kapitalismus darstellt. Nicht nur marxistische, auch andere avancierte Gesellschaftstheorien vertreten die Ansicht, dass sich moderne Verhältnisse durch eine Anonymisierung und Verselbständigung gesellschaftlicher Teilbereiche auszeichnen - ob diese als Systeme, Diskurse, soziale Felder oder Technologien bezeichnet werden, hängt dabei vom jeweiligen theoretischen Zugang ab. Materialistische Rechtstheorie hat zur Prämisse, dass eine von vielfältigen Antagonismen durchzogene und durch Konkurrenz geprägte Gesellschaft nicht das bewusste Produkt einer gesellschaftlichen Übereinkunft sein kann, sondern sich hinter dem Rücken ihrer Mitglieder, durch deren Praxis hindurch, in prekärer Weise vermittelt über soziale Formen herstellt.
Die Rechtsform vermittelt in diesem Zusammenhang die Gesellschaftlichkeit der Einzelnen, indem sie sowohl gegeneinander vereinzelte Subjekte produziert, als auch im gleichen Augenblick deren Neuzusammensetzung zu einer äußeren gesellschaftlichen Einheit bewerkstelligt. Die Arbeitsweise der Rechtsform besteht somit aus einer ganz spezifischen Subjektivierung sowie einer besonderen Weise gesellschaftlicher Kohäsion. Die Subjektivierung des Rechtssubjekts besteht in der oben kritisierten Produktion der abstrakten, einheitlichen, vereinzelten und autonomen Monade, die als naturalisierte Voraussetzung jedes Gesetzes wiederum so erscheint, als werde sie durch dieses lediglich reguliert. Das Subjektivierungsverfahren der Rechtsform operiert nach dem Modus der Abstraktion: Dadurch werden zugleich die differenten Einzelnen als abstrakt gleiche zueinander in Verbindung gesetzt. Die gesellschaftlich produzierte Gleichheit durch Abstraktion, hier von den je konkreten, differenten Einzelnen, ist der zentrale Modus, um Inkommensurables kommensurabel zu machen. Sie ermöglicht die Verbindung je individuierter Gesellschaftsmitglieder über Verträge, Gesetze, Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsakte. Über formalisierte Prozeduren und abstrahierende Normen wird ihre Gesellschaftlichkeit ermöglicht, werden die gegeneinander abgedichteten Einzelnen zu einem sozialen Gewebe verknüpft.
Da die Rechtsform ein zentrales Strukturprinzip, eine zentrale Vergesellschaftungsweise der Gesellschaften des globalen Nordens ist, ist Rechtlosigkeit gleichbedeutend mit dem Ausgeschlossensein aus eben diesen Gesellschaften. Der Diskurs über Rechte gesteht in der Tat unsere gesellschaftliche Abhängigkeit ein: »The mode of our being in the hands of others«, in den Worten Butlers (2004: 34). Rechtssubjektivität ist stets umkämpf. Es ist nicht ein für alle Mal festgelegt, wer dazu gehört, wem die Fähigkeit Rechtssubjekt zu sein, zugesprochen wird. Die Geschichte der Exklusion ist bekannt, sie traf Frauen und rassifizierte oder (post-)koloniale Andere. Heute sind es vor allem die Illegalisierten, denen der Rechtsstatus faktisch versagt wird. So problematisch die hegemoniale Subjektkonstitution durch das Recht auch ist, so lebensbedrohlich ist zugleich die Verweigerung der Rechtssubjektivität. Damit zeigt sich bereits in ihrer Arbeitsweise die widersprüchliche Grundstruktur der Rechtsform.
Der Spuk der Rechtsform
Soziale Formen operieren durch die Handlungen der gesellschaftlichen AkteurInnen hindurch. Diese abstrahieren, wenn sie sich gegenseitig als Rechtssubjekte behandeln, nicht in einem intellektuellen Vorgang sondern routiniert und ohne diskursives Bewusstsein in ihrer alltäglichen Praxis. Soziale Formen werden zu Kohäsionstechnologien, gerade weil sie scheinbar wie von selbst geschehen, hinter dem Rücken der Einzelnen. Menschliche Praxis verselbständigt sich in ihnen zu geronnenen gesellschaftlichen Verhältnissen, was sie zugleich verdecken. Verhältnisse zwischen Personen nehmen auf diese Weise den Charakter einer »gespenstigen Gegenständlichkeit « an, wie dies Georg Lukács formulierte (1968: 257). Das Besondere dieser Realabstraktionen besteht somit darin, dass sie keine bloß imaginären Abstraktionen in den Köpfen sind, sondern sich nur in der Praxis verwirklichen. Eine Fetischtheorie, die dies erklären will, ist damit in gewisser Weise eine Gespenstertheorie, eine Hantologie (Derrida 1995: 234).
Juridische Verfahren zeichnen sich durch eine hochgradige Eigenlogik aus: Ein selbstreferentielles Netzwerk bestehend aus Gesetzen, richterlichen Entscheidungen, Prozessordnungen, Kommentaren, Lehrbuchmeinungen, Klageschriften, Beweisanträgen, Rechtsphilosophien und -theorien subsumiert gesellschaftliche Sachverhalte unter juridische Kategorien, bzw. in das von Adorno beschriebene Gehege von Systematisierungen (s.o.). Die Verfahren überlassen das Recht nicht den Alltagshandlungen, sondern codieren gesellschaftliche Praxen in ihrer eigenen juridischen Semantik. In den Prozeduren werden die Entscheidungen der jeweiligen sozialen Kräfteverteilung entrissen und in die Sphäre des Rechts entrückt. Sie operieren durch eine spezifische Sprache, ein technisches Wissen, soziale Ausschließungsmechanismen und eigene Zeitvorgaben. Die einzelnen AkteurInnen können nicht mehr unmittelbar auf ihre Verhältnisse zurückgreifen, wenn sie erst einmal in die Verfahren Eingang gefunden haben, denn diese führen längst ein Eigenleben. Sie exkludieren die Subalternen und sind das klassische Terrain juridischer Intellektueller, welche die Techniken dieser Verfahren kennen. Diese beherrschen im Sinne Bourdieus die Spielregeln des juridischen Feldes (vgl. Nour 2008). Die Verfahren produzieren ihre eigene Realität - eine kontrafaktische Faktizität. Teil dieser Realität ist auch das Rechtssubjekt, das erst in den Verfahren konstituiert wird, dabei aber so erscheint, als ginge es ihnen voraus. Rechte zu besitzen erscheint als natürliche Eigenschaft, was erklärt, warum in der Genealogie der Rechtsform Naturrechtstheorien eine bedeutende Rolle spielten.
Die immer wieder kritisierte »Verhüllungsfunktion « des Rechts, welches die »wahren« politischen Verhältnisse verdecke, zeigt sich hier nicht als metaphysischer Vorgang, sondern als Effekt der Transformation sozialer Verhältnisse in rechtliche. Die rechtliche Realität ist nicht weniger wahr, als die soziale oder ökonomische, sondern eine rechtlich codierte. Die Dialektik der Rechtsform besteht darin, dass eine Verselbständigung sozialer Verhältnisse nicht aufgeht in dieser »Verhüllung «, dem Spuk der Rechtsform. Denn als ihren Effekt erzeugt sie notwendig eine relationale Autonomie. Es gibt keinen Generalstab des Kommandos, der einfach über sie verfügen könnte, indem er sie als sein Instrument einsetzte. Dies ist freilich ein beliebtes Klischee: Als könnten sich mächtige Einzelne oder auch »der Staat« einfach des Rechts zu ihrem Nutzen bedienen. Soziale Formen sind kein bloßer Schein, weil ihre Abstraktionsvorgänge eben nicht in den Köpfen sondern durch die Handlungen hindurch geschehen. Sie erlangen in ihrer Verselbständigung eine eigene Materialität.
Zu unterscheiden von der Rechtsförmigkeit sind Attrappen von Rechtlichkeit (Luhmann), das heißt Techniken, die sich selbst als rechtliche ausgeben, wie etwa die exekutivischen Verordnungen in der nationalsozialistischen »Gesetzgebung«, die aber längst nicht mehr der selbstreferentiellen juristischen sondern der Logik des politischen Systems folgen. Nur wenn das Recht sich selbständig nach der oben beschriebenen eigenen Logik reproduzieren kann, dann handelt es sich um die moderne Rechtsform mit ihrer relationalen Autonomie. Dieser eigene, verselbständigte Operationsmodus ist wesentlicher für das Spezifikum des Rechts, als das häufig dafür in Anschlag gebrachte staatliche Gewaltmonopol. Rechtliche Verfahren funktionieren in ihrer Selbstbezüglichkeit in den allermeisten Fällen jenseits auch nur der Drohung durch Gewalt, zudem hat Rechtsförmigkeit längst damit begonnen, sich jenseits der Nationalstaaten zu etablieren. Das Gewaltmonopol oder eine Verbindung von Gewaltmonopolen (wie in der EU) kann diese Verselbständigung stabilisieren. Es wäre jedoch ein etatistischer Fehlschluss, davon das »Wesen des Rechts« abzuleiten. Die Rechtsform ist relational autonom nicht nur von ökonomischen Interessen, sondern auch von der politischen Form. Mit dieser ist es historisch eng verbunden, nationale Gerichte sind als Staatsapparate institutionalisiert, zugleich ist es jedoch auch von ihr notwendig getrennt. Die richterliche Unabhängigkeit, die Notwendigkeit einer juristischen Argumentation und die spezifischen Verfahren folgen einer juridischen und keiner politischen Logik. So macht es eben, gegen Poulantzas und Agamben, einen Unterschied ums Ganze, ob staatliche Praxen gesetzlich definiert und reguliert sind, oder ob sie schlichtweg exekutiert werden. Es ist nicht »der Staat«, der das Gesetz macht, eine politologische Naturalisierung, sondern das selbstreferentielle juridische Netzwerk bringt das hervor, was als Recht gilt. Kritiken, die das Recht als die schiere Entäußerung des Staates beschreiben, hängen nicht nur einem überkommenen Souveränismus an, der Machtverhältnisse so konzipiert, als gingen sie von einer »Sonne der Souveränität« aus (Foucault 1998/1976: 114), sondern vor allem verkennen sie die verzwickte Materialität der Rechtsform.
Diese verselbständigte, gespenstische soziale Form mit ihren juridischen Verfahren ist der entscheidende Faktor für die widersprüchliche Grundstruktur des Rechts, für seine Vertracktheit im Mausschen Sinne. Sie entwickelt ein Übergewicht über die Einzelnen, enteignet sie vermittels dieser Verfahren und ist ihrem praktischen Bewusststein nicht zugänglich. Zugleich ist es jedoch auch diese Grundstruktur, die einen Aufschub der Macht bedeutet, die sich abschottet gegenüber unmittelbaren Zugriffen mächtiger Interessen. Denn wenn die Rechtsform relational autonom ist, kann sie nicht unmittelbar zur Machtausübung instrumentalisiert werden. Rechtliche Strategien verlangen vielmehr ein Einlassen auf die eigene Logik der juridischen Verfahren. Wenn der Begriff der »ethischen Funktion des Rechts« einen Sinn macht, dann diesen.
Hegemoniale normative Ordnung
Die Kräfteverhältnisse, und damit komme ich zum zweiten Moment des Verhältnisses von Rechtsform und konkreten Kämpfen um Hegemonie, können nach dem bisher Ausgeführten keine unmittelbare Abbildung im Recht finden, weil das durch die relationale Autonomie der Rechtsform blockiert wird. Das Ergebnis der juridischen Verfahren ist eine normative Ordnung: Sie normiert das, was rechtens ist, eine bestimmte Lebensweise und spezifische Kategorien (wie etwa ›Frau‹ oder ›Familie‹ bzw. ›eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb‹), welche Selbstführungspraktiken anleiten. Die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse schreiben sich in diese normative Ordnung ein - als hegemonialer Konsens. Hegemonie, verstanden als eine Weltanschauung, auf der die Vorlieben, der Geschmack, die Moral, die Sitten und die philosophischen Prinzipien der Mehrheit der Gesellschaft beruhen, und die sich im ganzen Gewebe des sozialen Lebens ausbreitet (vgl. Buckel / Fischer-Lescano 2007), findet dabei auf eine subtile Weise Eingang in die Rechtsform über die juridischen Verfahren.
Die juridischen Intellektuellen organisieren den hegemonialen Konsens unter den skizzierten materiellen Voraussetzungen der Rechtsform. Sie beherrschen mit der juristischen Argumentation eine spezifische Wissenstechnik und organisieren die Verfahren. Während die ›großen Intellektuellen‹, RechtsphilosophInnen und -theoretikerInnen Reflexionen über den Sinn und Zweck des Rechts sowie seine aktuelle Angemessenheit diskutieren, ist es der geschäftigen Alltagspraxis der ›kleinen Intellektuellen‹ vorbehalten, die sich strikter an konsentierte Maßstäbe halten (Demirovic 1999: 26), über ihre immanente Kenntnis des Rechtssystems Hegemonie in der juristischen Argumentation zu organisieren. Die Dogmatik ist das materielle Bezugsgerüst unterschiedlicher Normen und Entscheidungen, das einmal gefundene Lösungen in der Zeit fixiert und damit reproduzierbar macht, Rechtsfiguren etabliert, Systematisierung und Ausdifferenzierung ermöglicht und vielfältige Lösungsmodelle sowie vergangene Konflikte speichert.
Die juristische Argumentation schottet sich dabei gegen ein ständiges Hinterfragen ab und fungiert als »Stoppregel für Begründung suchendes Räsonnieren« (Luhmann 1995: 387). Indem sie nämlich als rein technisches, immanentes Vorgehen in Erscheinung tritt, als rechtliche Notwendigkeit - so die Hauptkritik der Critical Legal Studies (Kennedy 1997: 1 f.) - wird die Hegemonieproduktion ›invisibilisiert‹. Sowohl Rechtsdogmatik als auch Rechtstheorie gerieren sich so, als gäbe es einen letzten legitimen und vor allem eher technisch-neutralen Grund für die jeweiligen Entscheidungen. Hegemonie wird demnach genau an der Bruchstelle der Rechtsform bedeutsam, dem fragilen Legitimitätsanspruch ihrer Rechtsfiguren. Das ist der Moment, da es den juridischen Intellektuellen gelingen muss, eine hegemoniale Argumentation zu entwickeln, also eine solche, die einen ›politisch- ethischen‹, wenngleich auch asymmetrischen Konsens, einen komplexen ›Kollektivwillen‹, auf der Basis des aktuellen Kräfteverhältnisses formuliert.
Die juristische Argumentation bietet für diese hegemoniale Praxis eine Art Infrastruktur zur Universalisierung hegemonialer Projekte. Sowohl die Abstraktheit als auch die formalisierten Begründungsprozeduren bieten mit den bereits etablierten Rechtsfiguren - und deren Fixierung, Systematisierung und Reproduzierbarkeit - ein Reservoir für die Argumentation, die dadurch ihrer Willkürlichkeit im Sinne eines partikularen Interesses durch eine Art Formzwang enthoben ist. Hegemoniale Kämpfe werden über diesen Formzwang also normiert, wobei die Rechtsform als eine Art Universalisierungsrelais funktioniert: Bürgerliche Herrschaft ist nach der Erkenntnis Gramscis auf Kompromisse mit den und Zugeständnisse an die Beherrschten angewiesen, auf eine Universalisierung der dominanten gesellschaftlichen Interessen, die nur auf diese Weise intellektuell, kulturell und politisch führend werden können. Die bürgerliche Klasse hat so zur Verallgemeinerung ihrer Lebensweise Superstrukturen (wie das Recht) hervorgebracht, als organisatorische Aktivitäten, die gesellschaftliche Ziele formulieren (Demirovic 2007: 31). Dergestalt werden die in die normative Ordnung eingehenden Positionen universell und damit hegemonial. Eine Definition des Rechts als repressive, durch das staatliche Gewaltmonopol gekennzeichnete Herrschaftstechnik verkennt somit nicht nur die eigene Materialität des Rechts sondern darüber hinaus seine Hegemonie organisierende Funktionsweise. Für Gramsci war immer klar, dass das Zwangsmoment des Rechts nur ein und im Zweifel der unwichtigere Anteil seines integralen Charakters ist.
Rechtsfiguren sind sedimentierte strategisch- selektive Produkte vergangener Auseinandersetzungen. Eine Argumentation, die diese einfach ignorierte oder sich ohne Begründungsaufwand davon distanzierte, offenbarte sich als willkürliche. JuristInnen können insofern die Gesetze schlechterdings nicht einfach nach ihrem Belieben resignifizieren, wie Butler dies unterstellt. Die Argumentation muss die hegemonialen Rechtsfiguren vielmehr aufnehmen und dadurch zugleich reproduzieren und verschieben - relationale Autonomie des Rechts in seiner alltäglichen Praxis. ›Herrschende‹ und ›Mindermeinungen‹ geben in unübertroffener Offenheit den aktuellen Zustand des hegemonialen Konsenses im Recht wider. Generalklauseln wie ›gute Sitten‹ oder die ›objektive Wertordnung‹ sind seine kaum verkleideten Platzhalter.
Gesellschaftliche Kräfte schreiben sich also entsprechend ihren Ressourcen und Strategien als hegemoniale und gegenhegemoniale Projekte in die Rechtsform ein, geben ihr die konkrete Gestalt. Das heißt notwendig, dass immer auch subalterne Interessen im Recht zum Ausdruck kommen, sofern es ihnen gelingt, die Verfahrensfilter zu überwinden und in die juristische Argumentation und Praxis Eingang zu finden (vgl. dazu Buckel 2008). So zeigt etwa der unlängst vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entschiedene Fall, indem einer ›homosexuellen‹ Frau ein Schadenersatzanspruch zugestanden wurde, weil die französische Regierung ihr die Adoption eines Kindes aus diskriminierenden Motiven aufgrund der ›sexuellen Orientierung‹ versagt hatte, was Art. 8 und 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention widerspricht (EGMR, Appl. No. 43546/02, Urteil vom 22.01.2008), dass eine spezifische vormals gegenhegemoniale Kritik heteronormativer Verfasstheit inzwischen Eingang in Gerichtsentscheidungen gefunden hat.
3. Vergesellschaftung der Rechtsform
Ich habe versucht zu zeigen, dass der ambivalente Umgang gesellschaftskritischer Bewegungen mit dem Recht nicht zufällig geschieht, sondern mit dessen eigener widersprüchlicher Grundstruktur zusammenhängt. Es kann als eine soziale Form analysiert werden, die nur durch theoretische Kritik zu entschlüsseln ist und sich als Macht-Wissen- Komplex durch die Alltagspraxen gesellschaftlicher AkteurInnen hindurch durchsetzt, ohne in deren praktisches Bewusstsein einzugehen. Sie subjektiviert die Einzelnen als kapitalistisch- patriarchale Monaden und fügt sie zu einer äußerlichen Einheit wieder zusammen. Ihre Verfahren produzieren eine hegemoniale normative Ordnung, die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen den Anschein universeller Gerechtigkeit vermittelt, indem die Verfahren die politische Imprägnierung ihrer Ergebnisse als technische Entscheidungen maskieren. Zugleich jedoch bedeutet sie aufgrund ihrer relationalen Autonomie immer auch einen Aufschub der Macht und ermöglicht über ihre Universalisierungsinfrastruktur das Einschreiben gegenhegemonialer Projekte, die dann ebenfalls mit der Dignität normativer Geltung versehen sind. Da diese normative Ordnung der offizielle Code der Macht ist, sind die in ihm eingefangenen gesellschaftlichen Machtverhältnisse in den formalen Prozeduren auch skandalisierbar, anders als die subtileren Mikromächte. Zudem sind prinzipiell alle Machtverhältnisse in den Zwischenräumen des Rechts als inoffizielle, unberechtigte Machtausübungen kritisierbar, gerade weil die Rechtsform als universeller und offizieller Code der Macht den Anspruch transportiert, dass es keine Machtverhältnisse jenseits seiner geben darf.
Ein kritischer Umgang mit dem Recht kann also weder in einer rechtsnihilistischen Absage noch in dem Versuch bestehen, sich des Rechts einfach als neutralen Instruments zu bedienen. Vielmehr ginge es darum, eine Aufmerksamkeit für seine widersprüchliche Arbeitsweise zu entwickeln: »In other words, how might the paradoxical elements of the struggle for rights in an emancipatory context articulate a field of justice beyond ›that which we cannot not want'?« (Brown 2000: 240)
Ein gesellschaftskritischer Ansatz könnte darauf hinauslaufen, in Kenntnis der Widersprüche der Rechtsform, ihre Materialität in Anspruch zu nehmen und ihre Verheißungen von realer Universalität und Gerechtigkeit weiter zu treiben. Dieses Einlassen auf die Rechtsform würde bedeuten, dass emanzipative gegenhegemoniale Politiken auch innerhalb des strategisch-selektiven Rahmens der Rechtsform verfolgt würden: Und das hieße immer auch, ein Einlassen auf die abstrakte Rechtssubjektivität, die Verfahren, die rechtliche Argumentation sowie die juristischen Intellektueller. Diese Strategie birgt offensichtlich Gefahren, denn ein bewusstloser Umgang damit reflektierte nicht, in welcher Weise die Subalternen durch das Recht passiviert werden. Passivierung meint hegemonietheoretisch die Nicht-Infragestellung der Arbeitsteilung zwischen Hand- und Kopfarbeit (hier der juridischen Intellektuellen) und damit die Blockade eigenständiger und neuer institutioneller Formen (Adolphs / Karakayali 2007: 124 f.). Gerade wegen der verselbständigten Verfahren ist diese Vorgehensweise zwangsläufig auf organische juridische Intellektuelle angewiesen, die sich im Gehege der Systematisierungen zurechtfinden. So haben sich, vor allem im transnationalen Recht, diverse linke Rechts- Think-Tanks herausgebildet, die in sich selbst wieder die Arbeitsteilung zwischen Kopf- und Handarbeit perpetuieren. Dies ist jedoch nicht unproblematisch, denn »insofern sie sich in bestehende hegemoniale Terrains einschreiben müssen, laufen gegenhegemoniale Projekte immer selbst Gefahr, zur Passivierung der Subalternen beizutragen« (ebd.: 126).
Eine emanzipative Bewegung hingegen muss maßgeblich auf eine Aktivierung der Subalternen hinauslaufen, auf die Mobilisierung ihrer Kreativität (ebd.: 125). Rechtstheoretisch würde dies eine Vergesellschaftung der Rechtsverhältnisse bedeuten, d.h. das Ziel wäre die gesellschaftliche Aneignung des Rechts, um aktivierende Subjektivierungsweisen, die aus Projekten alternativer Lebensweisen hervorgehen, institutionell abzusichern. Eine auf dieser Basis entwickelte eigene Weltanschauung könnte sich in die normative Ordnung, die die Rechtsform ist, einschreiben und über ihre Universalisierungsstruktur verallgemeinerbar werden. Dabei sind die juridischen Intellektuellen vorübergehend in Kauf zu nehmen. Ihr Status als ÜbersetzerInnen der Rechtsform im Kontext einer breiteren sozialen Bewegung wäre allerdings ein vorläufiger.
Dr. Sonja Buckel ist Wissenschaftlerin am Institut für Sozialforschung der Goethe Universität Frankfurt a.M. und Mitherausgeberin der Kritischen Justiz. Der vorstehende, gekürzte Beitrag erschien zunächst in dem Sammelband Kritik und Materialität, Alex Demirovic (Hg.): Schriftenreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, Bd. 1, Münster 2008, S. 110-131.
Literatur:
Adolphs, Stephan / Karakayali, Serhat (2007): Die Aktivierung der Subalternen - Gegenhegemonie und passive Revolution, in: Buckel / Andreas Fischer-Lescano 2007, 121-140.
Adorno, Theodor w. (1994): Negative Dialektik. GS, bd. 6, 8. Aufl. Frankfurt am Main.
Agamben, Giorgio (2002): Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Frankfurt am Main.
Baer, Susanne (1998), Inexcitable Speech. Zum Rechtsverständnis postmoderner feministischer Positionen in Judith Butlers »excitable Speech«, in: Antje Hornscheidt / Gabriele Jähnert / Annette Schlichter (Hg.): Kritische Differenzen - geteilte Perspektiven, Opladen 1998, 229-252.
Brown, Wendy (2000): Suffering Rights as Paradoxes, in: Constellations, 230-241.
Buckel, Sonja (2007): Subjektivierung und Kohäsion. Zur Rekonstruktion einer materialistischen Theorie des Rechts. Weilerswist.
- (2008): feministische erfolge im transnationalen Recht: Die juridische Aufarbeitung des japanischen Systems sexueller Sklaverei, in: Leviathan H. 1/2008.
- / Fischer-Lescano, Andreas (Hg.) (2007): Hegemonie gepanzert mit Zwang - Zivilgesellschaft und Politik im Staatsverständnis Antonio Gramscis. Baden-Baden.
Bung, Jochen (2007): Stichwort: Rechtskritik, in: Ders. / Brian Valerius / Ziemann Sascha (Hg.). Normativität und Rechtskritik. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Beiheft Nr. 114. Baden-Baden, 157-159.
Butler, Judith (1991): Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt am Main.
- (1993): Kontingente Grundlagen: Der Feminismus und die Frage der ›Postmoderne', in: Seyla Benhabib / Judith Butler / Drucilla Cornell / Nancy fraser (Hg.). Der Streit um Differenz. Frankfurt am Main, 31-58.
- (2004): Undoing Gender. New York.
- (2006/1997): Haß spricht: zur Politik des Performativen. Frankfurt am Main.
Demirovic, Alex (1999): Der nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der Kritischen Theorie zur Frankfurter Schule. Frankfurt am Main.
- (2007): Politische Gesellschaft - zivile Gesellschaft. Zur Theorie des integralen Staates bei Antonio Gramsci, in: Buckel/Fischer-Lescano 2007, 21-41.
Derrida, Jacques (1995): Marx' Gespenster. Der verschuldete Staat, die Trauerarbeit und die neue Internationale. Frankfurt am Main.
Elsuni, Sarah (2007): Zur ReProduktion von Machtverhältnissen durch juridische Kategorisierungen am Beispiel ›Geschlecht‹, in: Lena Behmenburg u.a. (Hg.). Wissenschaf(f)t Geschlecht. Machtverhältnisse und feministische wissensproduktion. Königstein (Taunus), 133-147.
Foucault, Michel (1998/1976): Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. 10. Aufl. Frankfurt am Main.
Frankenberg, Günter (2006): Partisanen der Rechtskritik. Critical Legal Studies etc., in: Sonja Buckel / Ralph Christensen / Andreas Fischer-Lescano (Hg.). Neue Theorien des Rechts. Stuttgart, 97-116.
Halley, Janet (2002): Sexuality Harassment, in: Dies. / Wendy Brown (Hg.). Left Legalism/Left Critique. Durham & London, 80-104.
Hutchinson, Allan C. / Monahan, Patrick J. (1984): Law, Politics, and the Critical Legal Scholars: The Unfolding Drama of American Legal Thought, in: Stanford Law Review, 36, 199-245.
Kannankulam, John (2008): Autoritärer Etatismus im Neoliberalismus. Zur Staatstheorie von Nicos Poulantzas. Hamburg.
Kennedy, Duncan (1997): A Critique of Adjudication. Cambridge Mass.
Kirchheimer, Otto (1976/1930): Reichsgericht und Enteignung: Reichsverfassungswidrigkeit des Preußischen Fluchtliniengesetzes?, in: Ders. / Wolfgang Luthardt (Hg.). Von der Weimarer Republik zum Faschismus: Die Auflösung der demokratischen Rechtsordnung. Frankfurt am Main, 77-90.
Kiss, Elizabeth (1995): Alchemy or fool‹s Gold? Assessing feminist Doubts About Rights, in: Dissent, 342-347.
Lobel, Jules (2004): Courts as Forums for Protest. Working Paper 213, Auf: law.bepress.com/expresso/eps/213, letzter Abr. 20.08.2007.
Luhmann, Niklas (1995): Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt am Main.
Lukács, Georg (1968): Die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats. Werke Bd. 2, in: Ders. Geschichte und Klassenbewusstsein. Neuwied/Berlin.
MacKinnon, Catharine A. (1993/1987): Difference and Dominance: on Sex Discrimination, in: D. Kelly Weisberg (Hg.). Feminist Legal Theory. Foundations. Philadelphia, 276-287.
Maus, Ingeborg (1995): Freiheitsrechte und Volkssouveränität. Zu Jürgen Habermas' Rekonstruktion des Systems der Rechte, in: Rechtstheorie, Bd. 26 Heft 4, S 507-562.
Neumann, Franz (1967/1937): Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der bürgerlichen Gesellschaft, in: Ders. (Hg.). Demokratischer und autoritärer Staat. Beiträge zur Soziologie der Politik. Frankfurt am Main, 7-57.
- (1980/1936): Die Herrschaft des Gesetzes. Frankfurt am Main.
Nour, Soraya (2008): Bourdieus juridisches Feld: die juridische Dimension der sozialen Emanzipation, in: Sonja Buckel / Ralph Christensen / Andreas Fischer-Lescano (Hg.). Neue Theorien des Rechts. Stuttgart, 2. Aufl.
Paschukanis, Eugen (1970/1924): Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. 3. Auflage. Frankfurt am Main.
Poulantzas, Nicos (1978): Staatstheorie: politischer Überbau, Ideologie, sozialistische Demokratie. 1. Aufl. Hamburg.
Smart, Carol (1989): Feminism and the Power of Law. London/ New York.
Stychin, Carl f. (1995): Law's Desire. Sexuality and the Limits of Justice, New York.