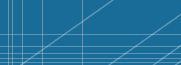Stellungnahme des RAV zum RefE des Bundesministeriums der Justiz für ein Gesetz zur Überarbeitung des Sanktionenrechts – Ersatzfreiheitsstrafe, Strafzumessung, Auflagen und Weisungen sowie Unterbringung in einer Entziehungsanstalt
vom 13. Juli 2022
Verfasser*innen: Ursula Groos, Rechtsanwältin, Berlin; Alexander K. Esser, Rechtsanwalt, München; Dr. iur. Lukas Theune, Rechtsanwalt, Berlin; Conrad Zimmer, Rechtsanwalt a. D., Berlin; Prof. Dr. iur habil. Helmut Pollähne, Rechtsanwalt, Bremen
Vorbemerkung
Das Sanktionenrecht bedarf in der Tat dringend der Überarbeitung, nicht nur, aber auch in den hier zunächst behandelten vier Themenfeldern. Dies umso mehr, als sich die ‚Kriminalpolitik‘ des Bundes in den letzten Jahren allzu sehr der Kriminalisierung und Strafverschärfung sowie der Sicherheitspolitik verschrieben hatte.
In diesem Sinne ist der vorliegende RefE grundsätzlich ein Schritt in die richtige Richtung. Die Verheißungen aus dem Koalitionsvertrag der „Fortschrittskoalition“ (dort S. 106), das Sanktionensystem „einschließlich Ersatzfreiheitsstrafen, Maßregelvollzug und Bewährungsauflagen“ zu überarbeiten „mit dem Ziel von Prävention und Resozialisierung“, hätten gleichwohl mehr Mut zum Fortschritt erwarten lassen.
I. Ersatzfreiheitsstrafe
Der RefE setzt das o.g. Versprechen aus dem Koalitionsvertrag in Bezug auf das vielfach auch grundsätzlicher Kritik ausgesetzte System der Ersatzfreiheitsstrafen allzu pragmatisch um. Die vorgeschlagene Regelung (zu § 43 StGB; zu anderen Änderungsvorschlägen s.u.) halbiert lediglich die Anzahl der Tage, die zu einer Geldstrafe Verurteilte als Haftstrafe absitzen müssen, die kein Gericht je gegen sie verhängt hat. Das ist allenfalls ein halber Schritt in die richtige Richtung. Von einer gründlicheren Überarbeitung kann indes keine Rede sein, und das ist zu bedauern, denn einer solchen bedürfte es.
Der RAV fordert ganz grundsätzlich, die Ersatzfreiheitsstrafe abzuschaffen. Dazu im Einzelnen:
1.
In Art. 104 Abs. 2 GG heißt es:
„Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden.“
Zwar hat das Bundesverfassungsgericht die Ersatzfreiheitsstrafe als mit der Verfassung vereinbar eingestuft (vgl. etwa Beschluss der 3. Kammer des 2. Senats v. 24.08.2006 - 2 BvR 1552/06), denn „der Richter“ – selbstverständlich auch Richter*innen – würde bereits mit der Festlegung der Tagessätze einer Geldstrafe inzidenter auf eine (Ersatz)Freiheitsstrafe erkennen für den Fall der Nichteinbringlichkeit der Geldstrafe.
Diese Auffassung halten wir für verfehlt. Im Urteilszeitpunkt geht das erkennende Gericht von der Einbringlichkeit der Geldstrafe aus und hält eine Freiheitsstrafe – gerade auch im Lichte des § 46 Abs. 1 S. 1 StGB – für unangemessen. Es hat überdies keinerlei Kenntnis davon, aus welchen Gründen die Geldstrafe letztlich durch die verurteilte Person ggf. nicht gezahlt werden kann. Insofern ist das System der Ersatzfreiheitsstrafe aus unserer Sicht nicht mit Art. 104 Abs. 2 S. 1 GG zu vereinbaren. § 43 StGB findet in der Hauptverhandlung auch gar keine Erwähnung, das Gericht ist noch nicht einmal verpflichtet, entsprechend zu belehren (und tut dies in aller Regel auch nicht). Das Gericht verliert mit anderen Worten über die „Zulässigkeit … einer Freiheitsentziehung“ gar kein Wort.
2.
Der RAV teilt im Übrigen die Auffassung, dass jedenfalls eine vorherige mündliche Anhörung vor der Entscheidung, nunmehr eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verhängen, durch ein Gericht verfassungsrechtlich geboten wäre (zumal [zu] viele Ersatzfreiheitstrafen auf Strafbefehlen basieren, vgl. Blessing/Daiqui 2022, https://verfassungsblog.de/ohne-anhorung-ins-gefangnis/). Dies wäre etwa durch eine Neuformulierung der §§ 459e und 459f StPO zu erreichen; der RAV schlägt hier vor:
Statt bisher (in § 459e StPO) „(1) Die Ersatzfreiheitsstrafe wird auf Anordnung der Vollstreckungsbehörde vollstreckt. (2) Die Anordnung setzt voraus …“ nunmehr neu:
„(1) Die Ersatzfreiheitsstrafe wird auf Antrag der Vollstreckungsbehörde vollstreckt. (2) Die Anordnung erfolgt durch das Gericht nach mündlicher Anhörung der verurteilten Person und setzt voraus …. Die Anordnung unterbleibt, wenn die Vollstreckung für die verurteilte Person eine unbillige Härte wäre.“
§ 459f StPO würde damit entfallen. Damit wäre sichergestellt, dass – in Strafbefehlsverfahren erstmals – ein Gericht prüft, ob tatsächlich unter Schuldgesichtspunkten eine Freiheitsstrafe verhängt werden kann, denn nichts anderes ist die Ersatz-Freiheitsstrafe de facto.
Das Gericht sollte zudem die Befugnis erhalten, auf der Grundlage neuer Erkenntnisse über die „persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse“ der verurteilten Person (vgl. § 40 Abs. 2 S. 1 StGB) die Höhe des jeweiligen Tagessatzes zu reduzieren.
3.
Auf der Grundlage schriftlicher Strafbefehlsverfahren sollte es niemals zur Anordnung einer Ersatzfreiheitsstrafe kommen.
Ungeachtet dessen setzt sich der RAV dafür ein, dass in Strafbefehlsverfahren immer eine Pflichtverteidigung bestellt wird. Denn in vielen Fällen handelt es sich bei den Verurteilten um Menschen, die nicht der deutschen Sprache und/oder nicht der Schriftsprache mächtig sind, die keinen Zugang zur Schriftsprache haben, die Rechtsbehelfsbelehrung nicht verstehen etc. Dem abzuhelfen ist am ehesten möglich über eine parteiische Verteidigung, die sich für die Interessen der Beschuldigten einsetzt, ihnen den Inhalt der Strafbefehle erklärt und gemeinsam mit ihnen bespricht, ob Einspruch eingelegt (und ggf. beschränkt) werden soll.
Eine solche Pflichtverteidigung wäre auf das Vollstreckungsverfahren nach (nicht selten vermeintlicher) Rechtskraft des Strafbefehls zu erstrecken.
4.
Bereits jetzt kann die Ersatzfreiheitstrafe durch Verurteilte abgewendet werden, wenn diese die Tilgung durch die Erbringung von Arbeitsleistungen vollbringen, Art. 293 EGStGB. Dies ist bislang eine Möglichkeit, die nur Verurteilte wahrnehmen können, die in der Lage sind, einen solchen Antrag bei der Staatsanwaltschaft zu stellen und sich dann selbstständig mit einem Träger, der dies anbietet, oder mit der Gerichtshilfe in Verbindung zu setzen. Auch hier sollte die Koalition mit Änderungen ansetzen, die über die geplante Erweiterung der Hinweispflichten (§ 459e Abs. 2 S. 2 neu) hinausgehen. Ein neuer § 459f StPO (nach Streichung des bisherigen, s.o.) könnte etwa lauten:
„Die Vollstreckungsbehörde hat der verurteilten Person anzubieten, die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe nach § 43 des Strafgesetzbuches durch freie Arbeit abzuwenden. Hierfür ist der verurteilten Person in einer ihr verständlichen Sprache ein geeigneter Träger vorzuschlagen, der über die entsprechenden Kapazitäten verfügt. Die Vollstreckungsbehörde kann die nähere Ausführung der Gerichtshilfe an dem Wohnort der verurteilten Person übertragen.“
5.
Eine Resozialisierung findet de facto in dem System der Ersatzfreiheitsstrafen nicht statt. Diese werden zudem nicht im offenen, sondern im geschlossenen Vollzug verbüßt. Hierfür gibt es keine Gründe.
Der RAV fordert daher jedenfalls festzulegen, dass eine Ersatzfreiheitsstrafe im offenen Vollzug verbüßt werden kann. Weder den Verurteilten noch der Gesellschaft noch dem Ziel der Resozialisierung ist geholfen, wenn Verurteilte durch die Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe ihre Wohnung, Arbeit und/oder Partnerschaft und Familie verlieren.
Geprüft werden sollte auch die Möglichkeit, eine Ersatzfreiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen.
6.
Der RAV hätte sich von der Ampelkoalition einen Vorschlag erhofft, der in der Tat den Prinzipien der Resozialisierung und Prävention verpflichtet ist. Hierzu würde es gehören, Beratungen von Beschuldigten zu stärken, etwa bereits existierende oder neu zu schaffende kostenfreie Strafbefehlsberatungen anzubieten (sei es durch die Gerichtshilfe, sei es durch freie Träger). Auf der Grundlage könnte festgeschrieben werden, dass ein Strafbefehl erst zwei Wochen nach der stattgefundenen Beratung rechtskräftig wird. Dazu müsste § 410 Abs. 1 S. 1 StPO wie folgt geändert werden – statt bisher: „Der Angeklagte kann gegen den Strafbefehl innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung bei dem Gericht, das den Strafbefehl erlassen hat, schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle Einspruch einlegen,“ neu:
„Die angeklagte Person kann gegen den Strafbefehl innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle eines Gerichts Einspruch einlegen. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn eine Beratung bei einer staatlich anerkannten Strafbefehlsberatungsstelle stattgefunden hat.“
So wäre sichergestellt, dass angeklagte Personen den Inhalt des Schriftstückes tatsächlich einmal zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Über Details dieses Verfahrens wäre noch zu reden.
7.
Nach den Ankündigungen im Koalitionsvertrag, das Sanktionssystem auch in puncto Ersatzfreiheitsstrafe „mit dem Ziel von Prävention und Resozialisierung“ zu überarbeiten, ist die beabsichtigte „Halbierung“ der Ersatzfreiheitsstrafe im Ansatz zwar (auch fiskalisch) begrüßenswert, im Ergebnis aber enttäuschend.
Im Übrigen weisen wir erneut auf die bereits bekannten Reformvorschläge des „Runden Tisches für Ausländische Strafgefangene in Berlin“ hin:
https://www.awoberlin.de/wp-content/uploads/2021/10/Ersatzfreiheitsstrafe-Reformempfehlungen-der-AG-Ersatzfreiheitsstrafe-fuer-die-Koalitionsverhandlungen.pdf
https://ersatzfreiheitsstrafe.de/wp-content/uploads/2019/06/Offener-Brief-zur-Abschaffung-der-ESF_v0619.pdf
II. Auflagen und Weisungen
Der im RefE unter A. geschilderten Problem- und Zielbeschreibung – die Anpassung des Sanktionenrechts des StGB an aktuelle Entwicklungen, die Stärkung von Resozialisierung und Prävention sowie die Haftvermeidung oder -verkürzung durch den Ausbau spezialpräventiv wirkender, ambulanter Maßnahmen – wird hier grundsätzlich gefolgt. Der unter B. dargestellte Lösungsansatz einer ausdrücklichen Normierung der Möglichkeit einer Therapieweisung im Rahmen der Strafaussetzung zur Bewährung (§ 56c StGB), der Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 59a StGB) und des Absehens von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen (§ 153a StPO), erscheint entsprechend der Erfahrungen und Statistiken notwendig, ist nach der hier vertretenen Auffassung jedoch weder ausreichend noch umfassend genug:
1.
Weisungen sollen die verurteilte Person darin unterstützen, keine Straftaten mehr zu begehen, und zielen darauf ab, deren Lebensführung spezialpräventiv zu beeinflussen. Nicht jede*r Straftäter*in benötigt eine Therapie oder erfüllt die Voraussetzungen, eine solche zu erhalten. Trotzdem kann ein Unterstützungsbedarf bestehen. Dafür kann die Beratung über einen gewissen Zeitraum / für eine gewisse Anzahl von Stunden in einer anerkannten und spezialisierten psycho-sozialen Beratungsstelle hilfreich und auch ausreichend sein.
Insofern plädieren wir für eine Erweiterung des
• § 56c Abs. 2 StGB um eine Nr. 7 wie folgt: „sich in einer anerkannten, spezialisierten psycho-sozialen Beratungsstelle beraten zu lassen (Beratungsweisung).“
• § 59 a Abs. 2 Nr. 6 StGB wie folgt: „oder sich in einer anerkannten, spezialisierten psycho-sozialen Beratungsstelle beraten zu lassen, oder“
• § 153 a Abs. 1 Nr. 6 StPO wie folgt: „oder sich in einer anerkannten, spezialisierten psycho-sozialen Beratungsstelle beraten zu lassen“
Der Zugang zu einer psycho-sozialen Beratungsstelle ist deutlich niedrigschwelliger als zu einer psychiatrischen, psycho- oder sozialtherapeutischen Behandlung. Dies kann motivierend auf die Straftäter*innen wirken, sich auf die Unterstützung und den Beratungsprozess einzulassen und wird für viele auch ausreichend sein.
Sofern sich im Rahmen eines solchen Beratungskontexts dann doch in Einzelfällen herausstellen sollte, dass weitergehende Unterstützung (z.B. eine Psychotherapie) notwendig ist, gehört es zum Selbstverständnis der Beratungsstellen, das mit den Klient*innen zu erörtern und diese bei entsprechender Motivation weiterzuvermitteln. Ein Vorteil gegenüber einer reinen gerichtlichen Therapieweisung wäre, dass die Klient*innen nicht auf sich gestellt sind, sondern im Beratungssetting bleiben, bis eine Anbindung an eine*n Therapeut*in gelingt. Teilweise können sie sogar auf ein bestehendes Therapeut*innen-Netzwerk rund um die Beratungsstelle zurückgreifen. Dies kann überfordernden und frustrierenden Erfahrungen vorbeugen, die aktuell oft dazu führen, dass Therapien nicht zustandekommen – und z.B. entsprechende Weisungen nicht erfüllt werden.
2.
Der für die Länder günstigen Kostenprognose des Entwurfs können wir nicht folgen.
a) Wenn das Gesetz nicht ins Leere laufen soll, dann braucht es bundesweit deutlich mehr Psychiater*innen und Psycholog*innen, die bereit und in der Lage sind, mit Gewalt- und Sexualstraftäter*innen zu arbeiten, also nicht vorrangig psychische Störungen, sondern kriminogene Faktoren zu behandeln.
An dieser Stelle soll klargestellt werden, dass es hier ein Bewusstsein dafür gibt, dass es weit überwiegend männliche Täter gibt. Allerdings wäre es aus unserer Sicht auch nicht verantwortlich, die relativ wenigen straffälligen Frauen, Trans- und Intermenschen unerwähnt und gänzlich ohne therapeutische oder beraterische Unterstützung zu lassen.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass bei Vorliegen entsprechender Indikationen (für psychische Störungen) die Therapien von den Krankenkassen zu finanzieren sind, braucht es doch Anstrengungen seitens der Länder und Kommunen, geeignete Therapeut*innen, Träger und Vereine zu finden, deren spezielle Angebote und Kapazitäten zu erfassen und diese Daten den Richter*innen zugänglich zu machen.
b) Weisungen laufen ins Leere, wenn Richter*innen diese Daten nicht haben und infolge dessen Maßnahmen benennen, die es gar nicht gibt, die nicht passend sind oder die benannten Träger/Vereine keine Kapazitäten haben.
Seitens der Angewiesenen können Weisungen nicht erfüllt werden, weil es die benannte Maßnahme nicht in zumutbarer Entfernung gibt oder sie überfordert damit sind, diese zu finden und zusätzlich auch noch die notwendigen Anträge zu stellen.
Hier werden Weisungsverstöße provoziert bzw. vorprogrammiert, weil Menschen in der Kommunikation mit Gerichten und Staatsanwaltschaften überfordert sind oder nicht wissen, dass man z.B. die Änderung oder Aufhebung von Weisungen beantragen kann. Im Falle der Unterstellung unter die Bewährungshilfe binden diese Korrespondenzen und Korrekturen (zu) viel der dortigen Arbeitszeit.
Für alle nicht indizierten Therapien (Behandlung kriminogener Faktoren) übernehmen die Krankenkassen die Kosten nicht. Sie wären von den Angewiesenen selbst zu tragen. Das ist ALG II-Empfangenden und Menschen mit geringem Einkommen nicht möglich.
c) Gleiches gilt für die Forensisch-Therapeutischen Ambulanzen (FTA). Hier werden bundesweit Wartelisten geführt, was dafürspricht, dass die Kapazitäten bereits jetzt schon nicht ausreichend sind.
d) Soll eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen und z.B. eine Umsetzung der Istanbul-Konvention gelingen, bedarf es entsprechend des Grundsatzes „Täterarbeit ist Opferschutz“ des flächendeckenden Auf- und Ausbaus von anerkannten, spezialisierten Beratungsstellen für Täter*innen insb. von
• (sexualisierter) Gewalt gegen Kinder, Frauen, LGBTIQ, Männer
• rassistischer und fremdenfeindlicher Gewalt
• Stalking
• Hate-Speech
e) Im Sinne der Prävention anhaltender, weiterer oder erneuter Straffälligkeit und somit auch der Resozialisierung bietet sich der pro-aktive Ansatz an.
In Berlin wird im Rahmen der Umsetzung der Istanbul-Konvention z.B. die Servicestelle Wegweiser (www.wegweiser-bln.de) seitens der Senatsverwaltung für Justiz und Vielfalt finanziert. Die Servicestelle kontaktiert proaktiv Menschen, denen grenzüberschreitendes Verhalten vorgeworfen wird, ermittelt im gemeinsamen Gespräch den Unterstützungsbedarf, berät über mögliche spezialisierte Beratungsangebote und vermittelt an diese weiter.
Teil der Arbeit ist es, das Hilfesystem, alle potentiellen anerkannten Beratungsangebote, deren Spezifika und Kapazitäten zu kennen und zu erfassen. Eine weitere Aufgabe besteht in der Erfassung fehlender Angebote. So gibt es etwa in Berlin außerhalb des Strafvollzugs und der FTA (Zugang setzt bisher vorherige Entlassung aus dem Straf- oder Maßregelvollzug voraus) kein einziges Therapie- oder Beratungsangebot für Menschen, die gegenüber Erwachsenen (zumeist Frauen) sexualisierte Gewalt ausüben.
f) Die Servicestelle (bzw. vergleichbare, bundesweit zu schaffende Stellen) könnte auch weitere, für Weisungen relevante Daten erfassen und diese sowohl Richter*innen als auch Angewiesenen zur Verfügung stellen. Außerdem könnten fehlende Angebote ermittelt, kommuniziert und deren Schaffung initiiert werden.
Im Rahmen von abgestuften Weisungen könnten hier Gespräche geführt werden, um konkrete Beratungs- oder therapeutische Behandlungsbedarfe festzustellen und passende Angebote mit ausreichend Kapazitäten zu ermitteln.
Das klingt zunächst nach mehr Aufwand, könnte aber geeignet sein, vielen Weisungsverstößen, aktuell vorzunehmenden Weisungsänderungen oder -aufhebungen vorzubeugen und der Umsetzung des Gesetzes dienen.
Kosten werden, wie oben dargestellt, entstehen. Inwiefern sie teilweise durch Einsparungen bei den Ersatzfreiheitsstrafen oder durch Haftvermeidungen oder -verkürzungen infolge erfolgreicher Weisungen kompensiert werden können, bleibt abzuwarten. Die Möglichkeit sollte genutzt werden.
IV. Unterbringung in einer Entziehungsanstalt
Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz des Kabinetts Merkel IV hatte im Oktober 2020 eine gemeinsame Bund-Länder Arbeitsgruppe von Justiz- und Gesundheitsministerkonferenz mit dem Ziel eingerichtet, einen Vorschlag zur Novellierung des Rechts der Unterbringung gemäß § 64 StGB zu erarbeiten. Da die Vorschläge jener AG sehr weitgehend in dem nun vorliegenden RefE aufgegangen sind, beziehen sich die folgenden Punkte darauf:
1.
Die AG hat zunächst festgestellt, dass ein dringender Reformbedarf vor dem Hintergrund steigender Unterbringungszahlen, einer Kapazitätsüberlastung der forensischen Kliniken und einer „geänderten Struktur der untergebrachten Personen“ bestehe. Dass die Unterbringungseinrichtungen in den forensischen Psychiatrien in allen Bundesländern sowohl quantitativ als auch qualitativ an ihren Belastungsgrenzen arbeiten (und nicht selten darüber hinaus), kann nicht bestritten werden: Das geht u.a. auf eine Verdoppelung der Zahl der gegenwärtig untergebrachten Personen seit dem Jahr 2002 zurück und wird von erheblichen Teilen der forensischen Psychiatrie seit Jahren mit einer Vehemenz beklagt, die als Hilferuf an die Politik verstanden werden muss (s. nur: Krankenhaus des Maßregelvollzugs: Therapiezugang reformbedürftig, Maybaum, Ärzteblatt 9/2019, S. 410).
Dieser „Hilferuf“ zeigt sich eindrucksvoll nicht nur an zahlreichen Aufsätzen in Fachzeitschriften und Vorträgen von Seiten der forensische Psychiatrie und Psychologie (s. auch Kollmeyer, Maßregelvollzug am Limit - § 64 StGB – Wann und wie lang?, abrufbar unter https://www.lwl.org/massregelvollzug-download/Abt62/Service/Dokumentationen/OLG-Tagung2013/2013-09-26_Kollmeyer,_Reinhard_OLG-Hamm_Para_64_StGB_Wann_und_wie_lang.pdf, zuletzt abgerufen am 24.08.2022). Darüber hinaus wird die Kapazitätsproblematik in Standardwerken der forensisch-psychiatrischen Fachliteratur auch im Hinblick auf die rechtlichen und medizinischen Voraussetzungen der Unterbringung nach § 64 StGB ausführlich dargestellt (vgl. nur Seifert in: Venzlaff/Foerster, Psychiatrische Begutachtung – Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen, hrsg. von Dreßing & Habermeyer, Kap. 28.1, Einleitung zur Unterbringung im Maßregelvollzug gemäß § 64 StGB, 7. Auflage 2021).
Teilweise scheinen sich diese Ausführungen als Aufforderung an psychiatrische Sachverständige darzustellen, das Bedürfnis nach einer Schonung der Kapazitäten bei der Gutachtenerstattung im Strafprozess zu berücksichtigen. Das Thema wird in letzterem Zusammenhang aus politischen bzw. fiskalischen Erwägungen erkennbar und bewusst an falscher Stelle platziert. Denn Kapazitätserwägungen dürfen bei der gutachterlichen Beurteilung des Vorliegens eines Hanges durch psychiatrische und/oder psychologische Sachverständige selbstverständlich keine Rolle spielen. Individuelle Beschuldigte in dem durch Sachverständige und Gerichte zu beurteilenden Einzelfall sind nicht weniger behandlungsbedürftig, nur, weil die zuständige Maßregelvollzugsanstalt aktuell ausgelastet ist.
Dies gilt nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes erst recht für die Entscheidung über die Unterbringungsanordnung durch die Strafgerichte. Eine Unterbringung ist danach auch dann anzuordnen, wenn es an einer Unterbringungseinrichtung (bzw. an entsprechenden Kapazitäten) im Zuständigkeitsbereich fehlt (BGHSt 28, 327), da es Aufgabe der Vollzugsbehörden der Länder ist, die Kapazitäten im Maßregelvollzug dem Bedarf anzupassen (BGHSt 36, 199).
Als Konsequenz dieser Fehlverortung der Kapazitätsproblematik ist in der Praxis der Strafverteidigung vermehrt zu beklagen, dass Sachverständige persönliche bzw. politische Überzeugungen zur Frage, wie mit der Kapazitätsproblematik umzugehen ist, in ihr Votum zum Vorliegen der Unterbringungsvoraussetzungen – mal mehr mal weniger verdeckt – mit einfließen lassen. In kaum einem forensischen Bereich kommt der Auswahl der Person der Sachverständigen eine solch entscheidende Rolle zu, wie bei der Begutachtung zur Frage der Voraussetzungen des § 64 StGB: Wie sehr Einstellungsfragen (etwa wenn sie selbst eine Entziehungsanstalt leiten) bei deren Votum von Bedeutung sind, zeigt sich auch daran, dass bei keiner anderen Sachmaterie die Strafgerichte die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt auch entgegen dem Votum der von Gericht oder Staatsanwaltschaft beauftragten psychiatrischen Sachverständigen anordnen, die doch eigentlich ihrer überlegenen Sachkunde wegen beauftragt wurden.
Wenngleich eine Diskussion über die Frage eines Reformbedarfs der Maßregel nach § 64 StGB legitim ist, ist der vorliegende Reformvorschlag im Lichte der vorskizzierten Reaktionen von Teilen der Psychiatrie zu sehen. Er zielt darauf ab, das Problem auf die denkbar einfachste und billigste Weise zu lösen: Weniger Feststellungen von Behandlungsbedarf = weniger Auslastung! Aus der Lektüre des Berichts der Bund-Länder Arbeitsgruppe ergibt sich, dass das Gremium ohne Zweifel durch diejenigen forensisch Tätigen aus Psychiatrie, Psychologie und Justiz besetzt gewesen sein muss, die eine Lösung der (unbestreitbaren) Kapazitätsproblematik ausschließlich durch Restriktionen an dem Institut der Unterbringung nach § 64 StGB suchen. Dies ist bedauerlich, da die Unterbringung nach § 64 StGB zumindest dem Anspruch nach wie kaum eine andere strafrechtliche Reaktion auf Kriminalität den Prinzipien des sozialen Rechtsstaats (Art. 28 Abs. 1 iVm 20 Abs. 3 GG) verpflichtet ist.
Die erarbeitete Gesetzesreform sieht Restriktionen an jeder dogmatisch denkbaren Stellschraube vor: Verengung des Hangbegriffs, gesteigerte Anforderungen an den symptomatischen Zusammenhang, erhöhte Voraussetzungen an die Feststellung der Erfolgsaussicht; zusätzlich soll unter Anpassung der Dauer des Vorwegvollzugs die Möglichkeit der Begleitstrafaussetzung zum Halbstrafenzeitpunkt nach § 67 Abs. 5 S. 1 StGB entfallen. Dazu im Einzelnen:
2. Zum Hangbegriff
Die vorgeschlagene Legaldefinition des Hangbegriffs, vor allem aber der diesen begleitenden Auslegungsvorschlag im Begründungsteil der Arbeitsgruppe, verengt das Leitbild behandlungsbedürftiger Drogensüchtiger auf das Literaturbeispiel der Kinder vom Bahnhof Zoo (Christiane F.: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo; nach Tonbandprotokollen aufgeschrieben von Kai Hermann und Horst Rieck, 1978).
Nach der vorgeschlagenen Legaldefinition soll die Annahme eines Hangs künftig (zumindest) „eine Substanzkonsumstörung, infolge derer eine dauernde und schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung, der Gesundheit, der Arbeits- oder der Leistungsfähigkeit eingetreten ist und fortdauert“ voraussetzen. Ausweislich der Entwurfsbegründung solle durch die Legaldefinition der Hangbegriff – ein eigenständiger unbestimmter Rechtsbegriff – an die medizinischen Begrifflichkeiten schädlicher Gebrauch (ICD-10 F.1) oder Abhängigkeitssyndrom (ICD-10 F.2) angenähert werden. Indes sollen nach der Legaldefinition und ihrer Begründung („schwerwiegende Beeinträchtigung“) nicht einmal mehr alle Fälle des - ohne Zweifel pathologischen - schädlichen Gebrauchs erfasst sein, sondern nur noch derjenige Missbrauch, „der nach ICD-10 als eine schwere Form des schädlichen Gebrauchs einzustufen ist“.
Dadurch würden Täter*innen aus dem Anwendungsbereich des § 64 StGB herausgenommen, bei denen evident ein Behandlungsbedarf besteht. Durch diesen Vorschlag werden jedoch Erkenntnisse aus neueren Studien aus dem Bereich der Suchttherapie verkannt, wonach die bisherige dichotome Differenzierung zwischen Abhängigkeit und Missbrauch im Sinne standardisierter Diagnostik künstlich ist, da es sich bei Missbrauch und Abhängigkeit um ein eindimensionales Kontinuum handeln dürfte (Rumpf & Kiefer, DSM-5: Die Aufhebung der Unterscheidung von Abhängigkeit und Missbrauch und die Öffnung für Verhaltenssüchte, 2011). Die entsprechende Differenzierung wurde vor diesem Hintergrund seit 2013 in der Neufassung des Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) aufgegeben. Nun wird zwar auch derzeit nicht bei jedem schädlichen Gebrauch im Sinne des ICD-10 oder einem jeden einfachen Missbrauch im Sinne des DSM-5 ein Hang angenommen. Es erscheint indes nicht angezeigt, die Unterbringung allein von der Schwere der Substanzgebrauchsstörung abhängig zu machen.
Vielmehr kommt es – mit der ständigen Rechtsprechung des BGH – darauf an, ob eine soziale Gefährdung festzustellen ist. Denn ob eine solche vorliegt, dürfte entscheidend dafür sein, ob der bestehende Substanzmissbrauch – ob er nun medizinisch eine Abhängigkeit oder einen wie auch immer gearteten schädlichen Gebrauch darstellt – die Behandlung im Maßregelvollzug erfordert oder nicht.
Was im Übrigen die Arbeitsgruppe ausweislich der Entwurfsbegründung verkannt hat ist, dass ein Gericht, beraten durch psychiatrische Sachverständige, zu prüfen hat, ob anstelle einer Unterbringung eine ambulante Therapie als Bewährungsweisung und/oder eine Aussetzung der Unterbringung im Maßregelvollzug zur Bewährung in Betracht kommt. Es wird bei weitem nicht in einem jeden Fall, in dem ein Hang im Sinne des § 64 StGB festzustellen ist, auch die Unterbringung angeordnet, sondern auf mildere Mittel wie die vorgenannten ausgewichen. Daneben greift § 35 BtMG je nach lokaler Anwendungspraxis Raum.
3. Zum symptomatischen Zusammenhang
Während nach derzeitiger Rechtslage der symptomatische Zusammenhang bereits dann anzunehmen ist, wenn der Hang allein oder zusammen mit anderen Umständen dazu beigetragen hat, dass Angeklagte die rechtswidrige Tat begangen haben, so soll § 64 StGB nun dahingehend geändert werden, dass eine Unterbringung nur noch in Betracht kommt, wenn festzustellen ist, dass die Tat überwiegend auf den Hang zurückgeht. Hierdurch soll einem – angeblich festzustellenden – „deutlichen Wandel in der Struktur der Klientel“ begegnet werden.
Dass eine solche Veränderung in der Klientel der Untergebrachten überhaupt stattgefunden hat, wird in dem Bericht allenfalls dahingehend begründet, als auf eine Veränderung der Delikte, die zur Unterbringung geführt haben, sowie darauf verwiesen wird, dass sich der Anteil der voll Schuldfähigen seit 1995 verdreifacht habe. Ansonsten werden zum Beleg dieser These lediglich Erfahrungsberichte angeführt von „dominant auftretenden Patienten, die außerhalb der Klinik einen Rückhalt im kriminellen Milieu hätten“, und die die Unterbringung vorrangig als Mittel zur Milderung ihrer hohen Begleitstrafe ansähen, und „durch deren Anwesenheit“ sich das Behandlungsklima in den Vollzugsanstalten verschlechtere.
Zum „Beleg“ dieser Erkenntnis werden Fachaufsätze aus der Praxis zitiert, die sich seit Jahren mit Vehemenz für Restriktionen bei der Maßregel des § 64 StGB stark machen (Schalast FPPK 2021, 179 und NStZ 2017, 433; Walther JR 2020, 296, 306; Müller FPPK 2019, 262, 299). Besonders im Blick hat die Arbeitsgruppe „Angeklagte, die aufgrund allgemeiner charakterlicher Mängel die verfestigte kriminelle Neigung aufweisen, Lebensbedürfnisse durch Straftaten zu bestreiten, Angeklagte mit dissozialer Charakterstruktur und – selbstverständlich – Großdrogendealer mit entsprechend hoher Begleitstrafe.“
Ungeachtet dessen, dass die Arbeitsgruppe schematisch von der wissenschaftlich nicht belegten These von der Existenz bestimmter Tätergruppen („Klientel“) ausgeht, steht der konkrete Vorschlag im Widerspruch zu den Erkenntnissen der forensischen Psychiatrie zur Frage des symptomatischen Zusammenhangs. Denn insoweit ist anerkannt, dass die Abgrenzung „süchtige Kriminelle vs. kriminelle Süchtige“ Schwierigkeiten birgt, ja mitunter unmöglich ist (Seifert aaO S. 435). Denn, wie gleichermaßen in den Justizvollzugsanstalten, weisen im Maßregelvollzug Untergebrachte vielschichtige biografische Belastungen auf: Fehlende Schul- oder Berufsausbildung, lange Phasen der Arbeitslosigkeit und vor allem ein strafrechtliches Vorleben. Jedenfalls eine – durch die vorgenannten Lebensbedingungen ggf. erworbene – dissoziale Persönlichkeitsakzentuierung dürfte vor diesem Hintergrund bei dem Gros der Untergebrachten vorliegen. Eine begleitende Persönlichkeitsstörung wird bei jeder vierten nach § 64 StGB untergebrachten Person diagnostiziert (Seifert aaO S. 440).
Vor diesem Hintergrund ergibt sich, dass Sucht zumeist nicht alleinige Ursache der Delinquenz ist, sondern naturgemäß auf ein Bündel von Ursachen zurückgeht. Auch bei sog. „Großdrogendealern“ sprechen keine Erkenntnisse dafür, dass die Sucht grundsätzlich minder ausgeprägt oder weniger behandlungsbedürftig wäre. Sofern diese tatsächlich eine untergeordnete Rolle bei der Tat spielte, wäre die Maßregel im Übrigen bereits nach heutiger Rechtslage nicht anzuordnen (vgl. nur BGH, Beschl. v. 08.12.2019 – 2 StR 331/19).
4. Zu den Erfolgsaussichten
Ebenso bedarf die Anordnung der Unterbringung gemäß § 64 StGB bereits heute der Feststellung des Bestehens einer „hinreichend konkreten Aussicht“, dass die betroffene Person von ihrer Sucht zu heilen oder für eine erhebliche Zeit vor dem Rückfall in den Hang zu bewahren ist.
Auch hier soll nach dem Willen der Arbeitsgruppe eine restriktivere Anordnungspraxis Platz greifen: Künftig soll der Therapieerfolg „aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zu erwarten“ sein. Der Gesetzgeber habe bei der Ausgestaltung der Grundlagen für die Anordnung und Durchführung der Maßregel die tatsächlichen Begebenheiten zu berücksichtigen, namentlich „die Begrenztheit staatlicher Mittel“. Es gebe kein verfassungsrechtliches Gebot, das den Gesetzgeber dazu veranlassen würde, die Maßregel auch in Fällen zweifelhafter Erfolgsaussicht zur Verfügung zu stellen.
Der Vorschlag verkennt, dass nach sämtlicher – selbst maßregelkritischer Literatur – schon die Erfolgsmessung staatlicher Unterbringung erhebliche Schwierigkeiten bereitet, mit der Konsequenz, dass allgemeingültige prognostische Erfolgskriterien erst recht kaum generalisierend zu benennen sind. Im Übrigen verkennt die Begründung des Reformvorschlags insgesamt – nicht nur hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals der Erfolgsaussicht – dass alle Anordnungsvoraussetzungen nach aktueller Rechtslage letztlich durch das Gericht zu belegen sind; keinesfalls greift der in dubio-Grundsatz (vgl. nur BGH, Beschl. v. 01.06.2021 – 6 StR 113/21).
Auch dieser Umstand birgt im Übrigen bereits jetzt die Gefahr, dass Fehleinweisungen in den Strafvollzug trotz bestehendem Behandlungsbedarf im Sinne der Maßregel erfolgen. Der Reformvorschlag würde falsche Nicht-Anordnungen noch vervielfachen. Es ist im Übrigen widersprüchlich, strengere Anforderungen an die Annahme eines Hanges zu fordern, gleichzeitig aber die Anforderungen an die Erfolgsaussicht zu erhöhen, denn eine höhergradige Abhängigkeit korrespondiert nicht selten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass die Therapiebemühungen ohne Erfolg bleiben.
6. Zur Begleitstrafenaussetzung und zum Vorwegvollzug
Nachdem die Arbeitsgruppe von einem „Missbrauch der Entziehungsanstalten“ durch Schwerkriminelle – und die Praxis der Strafverteidigung – ausgeht, stellt sich die Abschaffung der erweiterten Möglichkeit der Aussetzung der Begleitstrafe zum Halbstrafenzeitpunkt als das gravierendste Reformvorhaben dar. So soll nach § 67 Abs. 5 StGB eine Aussetzung der Reststrafe zum Zweidrittelzeitpunkt künftig die Regel sein.
Zwar sieht der Reformvorschlag ergänzend vor, dass unter den Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 StGB unter den dort genannten Voraussetzungen ausnahmsweise auch eine Entlassung zum Halbstrafenzeitpunkt in Betracht kommt. Diese Angleichung an die allgemeine Regelung des § 57 StGB läuft aber in all jenen Konstellationen ins Leere, in denen vor der Strafe ein Vorwegvollzug erfolgt (was in Anbetracht immer höherer Strafen in BtMG-Verfahren zur Regel geworden ist). Denn der Reformvorschlag sieht weiter vor, dass sich die Dauer bzw. die Berechnung des Vorwegvollzugs nach § 67 Abs. 2 StGB künftig am Zweidrittel-Zeitpunkt orientieren soll.
Damit wäre die Therapie bei allen Untergebrachten, bei denen zuvor Vorwegvollzug erfolgt ist, in aller Regel frühestens zum 2/3 Zeitpunkt abgeschlossen. Fälle eines außerordentlich zügigen Therapieverlaufs mit der Folge, dass eine Erledigung des Maßregelvollzugs früher erfolgen kann, sind reine Fiktion. Denn in der Begründung des Vorschlags wird freimütig festgestellt, dass selbst nach aktuellem Recht Therapien trotz der Berechnung des Vorwegvollzugs anhand der Möglichkeit der Aussetzung zum Halbstrafenzeitpunkt überwiegend weit über diesen Zeitraum hinaus andauern. So ergaben Auswertungen für sechs Bundesländer für das Jahr 2020, dass nur 18,4 % der Maßregeln auch nur nahe des Halbstrafenzeitpunkts beendet wurden, 21, 3 % nahe dem Zweidrittelzeitpunkt und 60,3 % gar nach dem Zweidrittelzeitpunkt. Vor diesem Hintergrund ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die Arbeitsgruppe gleichwohl davon ausgeht, dass das falsche Klientel die Entziehungsanstalten für die Erlangung der Halbstrafenmöglichkeit missbrauchen würde; diese Hypothese geht ausschließlich auf vermeintliches Erfahrungswissen zurück.
Selbst wenn man jedoch dieses einmal unterstellt, ist nicht im Ansatz nachzuvollziehen, weswegen es sich bei Möglichkeit der Erlangung einer Begleitstrafenaussetzung ab dem Halbstrafenzeitpunkt um einen sachwidrigen Anreiz für Angeklagte handeln sollte. Denn soweit die Fachliteratur von dem Bestehen eines solchen – nach vorgenannten Statistiken ohnehin irrig angenommenen – Anreizes ausgeht, so wird dieser von einer beachtlichen Ansicht als für die Therapiemotivation förderlich, teils sogar notwendig beschrieben (BT-Drs. 16/1110 S. 16; LK-Schöch, StGB, 12. Auflage, § 67 Rn. 97; Kett-Straub NStZ 2020, 474, 477).
Der Vorschlag der Arbeitsgruppe ist bereits deswegen systemwidrig, da eine Halbstrafenaussetzung nach § 57 Abs. 2 StGB im Grundsatz für alle Angeklagten in Betracht kommt. Durch den Reformvorschlag würden diejenigen Untergebrachten, die Vorwegvollzug zu vergegenwärtigen haben, gegenüber gewöhnlichen Strafgefangenen rechtlich sogar benachteiligt.
6. Alternativen?
Wessen Geistes Kind die Mitglieder der Arbeitsgruppe bzw. die von dieser angehörten Sachverständigen gewesen sein mögen, zeigt sich eindrucksvoll auf S. 35 des Berichts. Dort heißt es unter der Kapitelüberschrift „Alternativen“ zu dem Reformvorschlag schlicht: „Keine.“ Das ist absurd, denn solche bestehen offensichtlich, wären zumindest zu diskutieren gewesen, wozu es aber offenbar an der nötigen Bereitschaft fehlte.
Zum einen verspricht sich die Arbeitsgruppe bei der Anpassung des Vorwegvollzugs an den Zweidrittelzeitpunkt vor allem Kapazitätserleichterungen dadurch, dass bei positiven Behandlungsverläufen nach kürzerer Therapiedauer Entlassungen erfolgen könnten, da der Halbstrafenzeitpunkt bereits überschritten ist. Diese Erwägung einmal zugrunde gelegt, wäre der Arbeitsgruppe zuzustimmen, dass – bei entsprechendem Therapieerfolg – Entlassungen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu begrüßen sind. Dafür käme jedoch ebenso gut eine Reform des Gesetzes dahingehend in Betracht, dass für diese Ausnahmefälle eine Begleitstrafenaussetzung unabhängig von dem Erreichen des Halbstrafenzeitpunkts, also auch vor diesem Zeitpunkt, ermöglicht wird. Denn diese Erwägung ist ohnehin nur für Untergebrachte relevant, die Vorwegvollzug zu vergegenwärtigen haben: Wenn sie im Ausnahmefall wenige Monate vor dem Halbstrafenzeitpunkt entlassen würden, erfolgte dies keineswegs in unerträglicher Weise zu Lasten des staatlichen Strafanspruchs.
Will man mit dem Reformvorschlag davon ausgehen, dass Entziehungsanstalten durch „süchtige Kriminelle“ missbraucht würden, und dies vor dem Hintergrund der Möglichkeit einer Entlassung zum Halbstrafenzeitpunkt, so könnte dem übrigens auch dadurch begegnet werden, dass die Länder in ihrer Strafvollzugs- und -vollstreckungspraxis den Strafgefangenen die Halbstrafenaussetzung unter wortlautensprechender Gesetzesauslegung regelmäßiger zugutekommen lassen.
7. Fazit
Dem Reformvorschlag und seiner Begründung immanent ist der Gedanke der Fehleinweisung Angeklagter in die Entziehungsanstalten – und zwar nicht, weil es sich hierbei um eine belastende Maßnahme handeln könnte, sondern allein wegen der damit verbundenen Kosten für die Justiz- und Gesundheitsressorts.
Was in diesem Zusammenhang jedoch völlig übersehen wurde, ist die Gegenfrage: Wie viele Fehleinweisungen behandlungsbedürftiger Verurteilter in den Strafvollzug, bei denen die Voraussetzungen für eine Unterbringung nach § 64 StGB vorgelegen hätten, sind zu besorgen? Und vor allem: Wie viele Fehleinweisungen „krimineller Süchtiger“ wären zu besorgen, wenn der Reformentwurf umgesetzt würde? Der Reformvorschlag übersieht die Realität, nämlich, dass nach wissenschaftlichen Schätzungen jährlich 30.000 bis 40.000 suchtkranke Strafgefangene in deutschen Justizvollzugsanstalten einsitzen, also ohne Anordnung einer Maßregel gem. § 64 StGB (Seifert aaO S. 447). Danach stehen jeder im Maßregelvollzug nach § 64 StGB untergebrachten Person 10 entsprechende Verurteilte im Strafvollzug gegenüber. Dass mindestens ebenso häufig Fehleinweisungen in die andere Richtung erfolgen, und damit sowohl zulasten des Resozialisierungs- als auch des Sicherungsbedürfnisses, ergibt sich zwanglos aus diesen Zahlen.
Der Bund-Länder-AG ist vorzuhalten, vor den eklatanten Versorgungsproblemen der Justizvollzugsanstalten in puncto Drogenberatung und -therapie sowie Betreuung Gefangener mit Suchtproblemen die Augen zu verschließen.
Berlin, den 24.08.2022
Die Stellungnahme als PDF