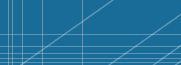Der RAV hat die hier folgende und ausführliche Stellungnahme eingereicht.
Zeitgleich wurde - kurz vor der mündlichen Anhörung - vom RAV, der BRAK, der RAK-Berlin und dem DAV eine Kurzfassung der RAV-Stellungnahme an die Mitglieder des Innen- und Rechtsausschuss sowie dem federführenden Ministerium zur Kenntnis und Berücksichtigung versandt. Diese Kurzfassung findet sich hier.
Hier nun die lange Fassung:
Verfasser*innen:
Rechtsanwältin Josephine Koberling, Rechtsanwältin Anya Lean, Rechtsanwalt Julius Becker, Rechtsanwalt Matthias Lehnert, Rechtanwalt Yunus Ziyal, Rechtsanwältin Inken Stern, Sebastian Pukrop (Rechtsreferendar), Rechtsanwältin Berenice Böhlo.
I. VORBEMERKUNGEN
Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, Maßnahmen zu ergreifen, damit »Asylverfahren […] fair, zügig und rechtssicher ablaufen«. Zugleich heißt es dort zu den Zielen der beabsichtigten Asylrechtsreform: »Wir wollen schnellere Entscheidungen in Asylprozessen sowie eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung«.
Diese Vorhaben sind grundsätzlich zu begrüßen: Die Praxis zeigt, dass die Asylverfahren auf behördlicher Seite sowohl qualitativ als auch zeitlich enorme Mängel aufweisen – insbesondere zu Lasten der Asylantragsteller*innen. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der im Verwaltungsrecht überdurchschnittlichen hohen Zahl gerichtlicher Entscheidungen, mit denen Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge aufgehoben und ein Schutzstatus zuerkannt wird und die die Fehlerhaftigkeit des behördlichen Asylverfahrens beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge offenbaren. Das Gleiche gilt spiegelbildlich für die im Ergebnis zumeist ergebnislosen Widerrufsverfahren nach einer Schutzanerkennung. Die jeweiligen gerichtlichen Verfahren dauern zu lang.
Die Bundesregierung hat nun ohne eine vorangegangene zivilgesellschaftliche Debatte einen Gesetzesentwurf zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren vorgelegt, der auch, nachdem bereits wesentliche Vorschläge zurückgenommen wurden, weiterhin erheblicher Kritik begegnet.
Dem entscheidenden Grund für die Länge der Asylverfahren, nämlich der mangelhaften behördlichen Verfahrens- und Entscheidungspraxis, wird mit diesem geplanten Gesetz indes nicht begegnet. Auch nach der Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurden im Jahr 2021 wieder lediglich 33,1% der Klageverfahren negativ – also klageabweisend – entschieden. Auf der Verwaltungsebene bedarf es daher einer deutlichen Qualitätsverbesserung.
Darüber hinaus findet der Gesetzesvorschlag auch keine Lösung für den fundamentalen Missstand und die grundlegende Ursache für die Verfahrensdauer der Asylgerichtsverfahren: Das BAMF tritt im gerichtlichen Verfahren in aller Regel nicht auf. Prozesserklärungen sind dann tatsächlich nicht möglich, oft sieht auch die interne Weisungslage des BAMF vor, dass trotz gerichtlichen Hinweises weder Abhilfeentscheidungen erlassen, noch der Verzicht auf mündliche Verhandlung erklärt werden. Dies führte z.B. in den gerichtlichen Asylverfahren zu langer Dauer und verhinderte systematisch die Verkürzung der Verfahren.
Nachdem die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag noch angekündigt hatte, Asylverfahren »fair, zügig und rechtssicher« zu gestalten, steht nunmehr eine Beschneidung von Verfahrens- und Prozessrechten zulasten von Asylsuchenden im Mittelpunkt. Diese weitere Aushöhlung des Asylrechts, die offensichtlich als Ausgleich für die Implementierung des – zudem noch unzureichenden – Chancenaufenthaltsrechts im Schnellverfahren durchgesetzt werden soll, ist nicht hinnehmbar.
Folgende maßgebliche Punkte sind daher besonders zu kritisieren:
1. Das Gesetzesvorhaben wird mit Sicherheit zu einer Verlängerung der Asylverfahren führen.
- Dem BAMF wird die Möglichkeit eingeräumt, eine Entscheidung im Asylverfahren bis zu 21 Monate (bisher 6 Monate) aufzuschieben, wenn im Herkunftsland eine »ungewisse Lage« besteht. Die Regelung lässt offen, wann eine solche Lage vorliegt und eröffnet dem BAMF die Möglichkeit, Entscheidungen zu Lasten der Schutzsuchenden fast zwei Jahre aufzuschieben. Unserer Erfahrung nach betrifft dies vor allem entscheidungsreife Fälle, die das BAMF nicht entscheiden möchte, da es politisch nicht opportun ist. Es besteht hier gar keine Regelungsnotwendigkeit. Bereits jetzt gibt es die Möglichkeit und die Behörde nutzt diese umfassend, zu temporären Entscheidungsstopps, gegenwärtig etwa in Bezug auf die Russische Föderation. Weiter entscheidet das BAMF bspw. bis jetzt keine älteren Asylanträge von Ukrainer*innen, deren Antragsteller*innen nicht der § 24 AufenthG-Regelung unterfallen. Auch im Falle von Afghanistan führte die Regierungsübernahme durch die Taliban zunächst zu einem Entscheidungsstopp. Abschiebungsverbote erteilte das BAMF erst flächendeckend, als klar wurde, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit deren Voraussetzungen weit überwiegend gegeben sieht. Die Neuregelung würde diese verfahrensverzögernde Praxis noch adeln und somit ausweiten.
- Dass bei Folgeanträgen das Vorliegen von Abschiebungsverboten nicht mehr geprüft werden soll, verstößt gegen das aus Art. 3 EMRK, Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 19 Abs. 4 GG entspringende Gebot, Abschiebungsverbote von Amts wegen in jeder Lage eines Verfahrens zu prüfen. Diese vorgeschlagene Regelung verursacht einen Prüfungsausfall und wird unmittelbar zu einem sprunghaften Anstieg des Stellens von Eilrechtsschutzanträgen vor Gericht führen. Das Gesetz führt also direkt zu mehr als zu weniger Verfahren.
- Ein im laufenden Klageverfahren gegen eine Unzulässigkeitsentscheidung erlassener Bescheid des BAMF, mit dem ein Asylantrag als unbegründet oder offensichtlich unbegründet abgelehnt wird, wird automatisch (ohne geäußertes Klagebegehren) in das Klageverfahren einbezogen. Dies ist ein Widerspruch zum Grundsatz der Dispositionsmaxime und führt zu Rechtsunsicherheit. Denn mit Aufhebung des Unzulässigkeitsbescheids dürfte sich das Klageverfahren erledigen. Es soll ein gesetzlicher Austausch von Streitgegenständen eingeführt werden. Dies führt zu unnötigen, ungewollten und noch längeren Gerichtsverfahren. Auch entfällt dadurch nicht die Pflicht des BAMF, eine volle inhaltliche Anhörung durchzuführen, die jedoch vor Erlass eines Bescheids erfolgen sollte.
- Zudem führt das Gesetz eine spezielle »Tatsachenrevision« durch das Bundesverwaltungsgericht ein und beschränkt zugleich die Revisionsmöglichkeiten für Betroffene. Das Bundesverwaltungsgericht soll nun zu bestimmten Tatsachenfragen einheitlich entscheiden. Eine Leitentscheidung kann aber für eine Vielzahl von Sachverhalten gar nicht verbindlich sein, da diese oft entscheidungserhebliche, individuelle Unterschiede aufweisen. Weiterhin kann eine solche Leitentscheidung nicht über eine längere Zeit verbindlich sein, da entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Asylverfahren bei volatiler Lage im Herkunftsland stets tagesgenau zu prüfen ist. So kann bei Veröffentlichung einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts die Situation, die der Entscheidung zugrunde lag, bereits völlig verändert sein. Statt einer Entlastung der Gerichte ist daher eine erhöhte Belastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, insbesondere des Bundesverwaltungsgerichts, zu erwarten.
2. Die anwaltliche Vertretung wird stark eingeschränkt.
- Im Asylklageverfahren vor dem Verwaltungsgericht gestellte Befangenheitsanträge gegen einzelne Richter*innen sollen nicht mehr dazu führen, dass die Verhandlung bis zur Entscheidung zu unterbrechen ist.
- Der diesen Vorschlägen offenbar zugrundeliegende Vorwurf an die Rechtsanwält*innen, sie würden durch Befangenheitsanträge Verfahren verzögern (wollen), entbehrt jeglicher empirischen Grundlage. Befangenheitsanträge werden stets mit Bedacht, nur bei Anlass und daher sehr selten gestellt. Eine kleine Umfrage unter im Migrationsrecht tätigen Kolleg*innen hat ergeben, dass ein solcher Antrag nur in absoluten Ausnahmefällen - und nicht selten dann erfolgreich - gestellt wird. Es besteht kein Anlass zu weiterem asylrechtlichen Sonderrecht.
- Im Ergebnis zementiert und befördert das Gesetz den bereits jetzt erheblichen Unterschied zwischen Rechtsschutz suchenden Asylsuchenden und in anderen Lebensbereichen Rechtsschutzsuchenden und schafft ein Zweiklassenrecht. An der Empirie, dass sehr viele Entscheidungen des BAMF durch die Verwaltungsgerichte mindestens teilweise aufgehoben werden, wird das Gesetz nichts ändern. Behördeninterne Controlling-Prozesse, weiterführende Schulungen der Mitarbeiter*innen, bessere Qualitätsstandards für Sprachmittelnde im Verfahren, Ressourcenausbau, Erweiterung der Berufungszulassungsgründe, die zu einer Verbesserung der Entscheidungspraxis und schließlich auch zu einer Beschleunigung und Entlastung auch der Verwaltungsgerichte führen würden, suchen wir vergebens. Die Notwendigkeit und Wirksamkeit der angestrebten Gesetzesänderungen lassen sich empirisch nicht belegen. Unsere Erfahrung mit dem Asylverfahren ergibt, dass eine Verbesserung der Qualität der Entscheidung des BAMF und der Asylverfahren im oben genannten Sinne viel eher zur Beschleunigung und Vereinfachung der Verfahren führen würden, als für die Gruppe der Asylsuchenden rechtsstaatliche Standards stetig abzubauen und das Recht auf Asyl zu beschränken.
II. ZUM ENTWURF IM EINZELNEN
1. § 12a AsylG-E: Asylverfahrensberatung
a. Bisherige Rechtslage
Nach der bisherigen Rechtslage (§ 12a AsylG) ist eine »freiwillige, unabhängige staatliche Asylverfahrensberatung« vorgesehen. Diese Verfahrensberatung erfolgt gem. § 12a S. 2 AsylG in zwei Stufen: Zunächst ein Gruppengespräch mit Informationen zum Ablauf des Asylverfahrens und auf der zweiten Stufe eine individuelle Asylverfahrensberatung, die entweder vom Bundesamt oder durch Wohlfahrtsverbände durchgeführt wird (§ 12a S. 3 AsylG). Die Vorschrift wurde am 15.08.2019 (Inkrafttreten: 21.08.2019) in das AsylG eingefügt. Die Regelung dient auch der Umsetzung der Vorgaben aus der EU-Verfahrensrichtlinie (RL 2013/32/EU), insbesondere aus Art. 19 und 20.
Diese bestehende Regelung ist zunächst zu kritisieren, weil auch drei Jahre nach ihrer Einführung noch immer bei weitem nicht alle Asylsuchende an einer individuellen Asylverfahrensberatung teilnehmen. Eine derartige Beratung ist jedoch erstrebenswert, da sie aufgrund besserer Vorbereitung der Betroffenen die Qualität der persönlichen Anhörungen erhöht, damit helfen kann, Zeit einzusparen, sie auch aus rechtsstaatlicher Perspektive wünschenswert ist und letztlich die Akzeptanz der Entscheidungen des Bundesamts bei den Betroffenen erhöht. Der Fokus sollte hierbei auf der individuellen Beratung liegen; die allgemeinen Gruppengespräche zur Information über das Asylverfahren sind zwar ebenfalls grundsätzlich positiv zu bewerten, dürften aber auf die Qualität der Asylverfahren nur einen geringen Einfluss ausüben.
Insbesondere problematisch an der bestehenden Regelung ist jedoch, dass das Bundesamt selbst eine gleichzeitig ›staatliche‹ und ›unabhängige‹ Verfahrensberatung durchführen soll. Zwar ist auch bei der bestehenden Regelung vorgesehen, dass Wohlfahrtsverbände auf der zweiten Stufe der Verfahrensberatung tätig werden können. Dies ist jedoch nur optional, und es ist mindestens gleichberechtigt eine Beratung durch das Bundesamt selbst vorgesehen. Eine ›staatliche‹ Beratung durch die Behörde, die selbst die Entscheidung im Asylverfahren trifft, kann jedoch nicht als unabhängig gewertet werden, womit die bisherige Regelung zur Asylverfahrensberatung grundsätzlich falsch konstruiert ist.
b. Reformentwurf und Bewertung
Dieser strukturelle Fehler des § 12a AsylG wird mit der vorgesehenen Änderung aufgehoben. § 12a Abs. 1 AsylG-E spricht nicht mehr von ›staatlicher‹, sondern über eine »behördenunabhängige, unentgeltliche, individuelle und freiwillige« Asylverfahrensberatung. Zwar werden Wohlfahrtsverbände nicht explizit in der Norm genannt, es erschließt sich jedoch, dass insbesondere diese zukünftig für die Verfahrensberatung zuständig sein sollen. Hierzu sollen diese mit Haushaltsmitteln gefördert werden (§ 12a Abs. 1 AsylG-E).
Positiv zu bewerten ist auch, dass die Verfahrensberatung bis zur unanfechtbaren Entscheidung des Bundesamtes durchgeführt werden kann und somit auch das Klageverfahren umfasst (§ 12a Abs. 2 S. 2 AsylG-E), wenn auch der Entwurf an dieser Stelle etwas missverständlich formuliert ist.
Auch ist zu begrüßen, dass im Rahmen der Verfahrensberatung in Fällen von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten eine Übermittlung derer Daten an das Bundesamt stattfinden soll. Es ist zu hoffen, dass dadurch die vorgesehenen Verfahrensgarantien für besonders schutzbedürftige Geflüchtete mehr zur Anwendung kommen (§ 12a Abs. 3 AsylG-E). An dem grundsätzlichen Zustand, dass besonderer Schutzbedarf häufig gar nicht erst erkannt wird, ändert dies wenig.
Ferner wird aus dem Entwurf nicht abschließend klar, ob die individuelle Verfahrensberatung eine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) oder nur eine abstrakte Informationsvermittlung darstellt. Dies ist unter der bestehenden Rechtslage umstritten. Zu fordern ist eine diesbezügliche Klarstellung. Zwar sieht § 12a Abs. 2 S. 1 AsylG-E vor, dass die besonderen Umstände des Ausländers zu berücksichtigen sind. Dennoch ist der genaue Umfang der Verfahrensberatung auch unter dieser Formulierung weiter unklar und wird insofern auch zukünftig für Streit sorgen.
Ebenfalls ist den Organisationen, welche die Verfahrensberatung anbieten, gesetzlich der Zugang zu Erstaufnahmeeinrichtungen einzuräumen, damit die Beratung von den Betroffenen auch tatsächlich und niederschwellig in Anspruch genommen werden kann.
Wünschenswert wäre zuletzt eine gesetzliche Klarstellung, dass die Verfahrensberatung auch in Folge- und Widerrufsverfahren in Anspruch genommen werden kann. Auch dies ist unter der aktuellen Regelung ungeklärt und sorgt für Streit.
c. Empfehlung
Da der Gesetzesentwurf nicht weit genug geht, wird empfohlen, die Änderungen mit den folgenden Zielen einzuarbeiten:
- Klarstellung, dass die individuelle Verfahrensberatung eine Rechtsberatung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG) und nicht nur eine abstrakte Informationsvermittlung darstellt
- Zugang zu Erstaufnahmeeinrichtungen für Organisationen zum Zwecke der Asylverfahrensberatung
- Klarstellung, dass Asylverfahrensberatung auch in Folge- und Widerrufsverfahren in Anspruch genommen werden kann
2. § 17 AsylG-E: Hinzuziehung eines Dolmetschers im Wege der Bild- und Tonübertragung
a. Bisherige Rechtslage
Bisher regelte die Norm, dass bei der Anhörung »ein Dolmetscher, Übersetzer oder sonstiger Sprachmittler hinzuzuziehen [ist], der [...] zu übersetzen hat«.
b. Reformentwurf und Bewertung
Die Hinzuziehung soll nun auch durch Bild- und Tonübertragung in Ausnahmefällen möglich sein.
Die Neuregelung begegnet, was den Einsatz der notwenigen Technik betrifft, datenschutzrechtlichen Bedenken, die in der Praxis geklärt sein müssten und es bisher nicht sind.
Es ist auf Folgendes hinzuweisen: Sowohl die Qualität von Dolmetscher*innen als auch das Vertrauensverhältnis zwischen Dolmetscher*innen und Antragsteller*innen ist bereits im status quo ein Problem.
Diese Probleme werden durch den Reformentwurf nochmal verschärft, jedenfalls nicht geklärt. Der Vorschlag scheint den Aspekt, dass die Qualität durch eine solche Praxis gemindert wird, auch zu erkennen, wenn er andererseits vorschlägt, dass nur »ausnahmsweise in geeigneten Fällen« die Übersetzung auf diesem Wege möglich sein soll. Das Ziel der Regelung ist derweil, das Verfahren zu vereinfachen, wenn eine geeignete Übersetzung vor Ort nicht möglich ist. Eine solche Vereinfachung geht zu Lasten der Antragsteller*innen –, indem es ein Vertrauensverhältnis erschwert, und auch die erforderliche Nähe, die für Nuancen in einer Übersetzung nötig sein können, aufhebt.
Schließlich stellt sich die Frage, wie und woher das BAMF vor der Anhörung die »geeigneten Fälle« erkennen will, zumal häufig – und gerade in den genannten Fällen – die besondere Schutzbedürftigkeit erst im Lauf der Zeit (oft auch erst nach sensibler Beratung) geäußert bzw. erkannt wird.
c. Empfehlung
Für eine Hinzuziehung ist zwingend die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Person notwendig. Diese ist als mündliche Erklärung zu Beginn der Anhörung aufzuzeichnen und als Wortprotokoll dem Anhörungsprotokoll beizufügen. Die antragstellende Person soll sich dazu äußern können, warum sie nicht lieber eine persönliche Übersetzung wünscht.
3. § 24 AsylG-E: Entscheidungszeitraum
a. Reformentwurf und Bewertung
Der Gesetzesentwurf setzt die in Artikel 31 Abs. 3-5 der Richtlinie 2013/32/EU (Asylverfahrensrichtlinie) geregelten Entscheidungsfristen in nationales Recht um. Die Neuregelung ist einerseits zu begrüßen, denn sie schafft Klarheit und Rechtssicherheit für Betroffene, Behörden, Gerichte und Beratende. Die Regelung adressiert auch diejenigen Stellen, die dem Bundesamt »zuarbeiten«, indem sie aktuelle Erkenntnismittel zur allgemeinen Lage oder spezifischen Konstellationen zur Verfügung stellt oder auf deren Weisungen und Entscheidungsleitlinien das Bundesamt Bezug nimmt. Auch sie sind gefordert, die Einhaltung der neu eingeführten Fristen zu ermöglichen.
Die Möglichkeit des Bundesamts, die Entscheidung bis zu 21 Monate aufzuschieben, wenn im Herkunftsstaat eine »ungewisse Lage« besteht, sodass eine Entscheidung vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, ist in der vorgeschlagenen Fassung zu unbestimmt und eröffnet die Möglichkeit, Entscheidungen zu Lasten der Schutzsuchenden fast zwei Jahre aufzuschieben. Unserer Erfahrung nach betrifft das vor Allem entscheidungsreife Fälle, die das BAMF nicht entscheiden möchte, da es politisch nicht opportun ist. So entscheidet das BAMF bspw. bis jetzt keine älteren Asylanträge von Ukrainer*innen, deren Antragsteller*innen nicht der § 24 AufenthG-Regelung unterfallen. Auch im Falle von Afghanistan führte die Regierungsübernahme durch die Taliban zunächst zu einem Entscheidungsstopp. Abschiebungsverbote erteilte das BAMF erst flächendeckend, als klar wurde, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit deren Voraussetzungen weit überwiegend gegeben sieht. Die Neuregelung würde diese verfahrensverzögernde Praxis rechtlich absichern und somit ausweiten.
b. Empfehlung
Die Möglichkeit des Bundesamts, die Entscheidung bis zu 21 Monate aufzuschieben, wenn im Herkunftsstaat eine »ungewisse Lage« besteht, sodass eine Entscheidung vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, ist abzulehnen.
4. § 25 AsylG-E: digitale Anhörung
a. Reformentwurf und Bewertung
Die Anhörung stellt das Kernstück des behördlichen Asylverfahrens dar. Sie hat in einem geschützten Raum und durch angemessene Befragung zur Übermittlung höchstpersönlicher Daten zu erfolgen. Dies ist in einer digitalen Anhörung nicht möglich.
b. Digitale Anhörung
Folgende Ausgangslage ist zu beachten:
- Eine Vielzahl von Antragsteller*innen sind keine ›digital natives‹. Das bedeutet, dass entsprechende technische Möglichkeiten sowie unterstützendes und technisch versiertes Personal zu ihrer Unterstützung hinzugezogen werden müsste. Es handelt sich aber um sensible Informationen, die den Kernbestand des Datenschutzes und Sicherheitsinteresse der Betroffenen tangiert. Das Herstellen eines notwendigen Grundvertrauens ist durch die Hürde der Videokonferenz erschwert. Der Vortrag eines Fluchtschicksals bspw. Schilderungen von Folter über Videokonferenz setzt einen geschützten, vertrauensvollen Rahmen voraus.
- Die vorgeschlagene Regelung wirft neben rechtlichen Problematiken erhebliche praktische Umsetzungsprobleme auf und ist abzulehnen.
- Es besteht auch keine Regelungsnotwendigkeit. So das Verfahren innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen sein soll, findet die Anhörung (vgl. § 47 Abs. 1 AsylG) zwingend in der Aufnahmeeinrichtung statt. Es erschließt sich nicht, weshalb am selben Ort Anhörer*in und Antragsteller*in in zwei verschiedenen Räumen sitzen sollten, um eine – wohl unbestrittene in der Qualität schlechtere – Anhörung durchzuführen.
c. Empfehlung
Eine Anhörung per Video kann in Aufnahmefällen und nur auf ausdrücklichen Wunsch und mit ausdrücklicher mündlicher Zustimmung erfolgen. Eine Entscheidung unter Verzicht auf die persönliche Anhörung kann nur auf Wunsch der schutzsuchenden Person und mit individuell verfasster Zustimmung erfolgen.
5. § 31 AsylG-E: Entscheidung des BAMF
hier: Änderung von Absatz 3 S. 2:
In Absatz 3 Satz 2 wird nach den Wörtern »anerkannt wird« das Wort »oder« durch ein Komma ersetzt, und nach den Wörtern »zuerkannt wird« werden die Wörter »oder durch das Bundesamt in einem früheren Verfahren über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 und 7 des Aufenthaltsgesetzes entschieden worden ist« eingefügt.
In Absatz 3 wird Satz 2 ergänzt und erweitert. Bisher regelte der Abs. 3, dass im Falle der Zuerkennung eines Schutzstatus nach dem AsylG keine Abschiebungsverbote mehr geprüft werden müssen. Das macht Sinn, da der internationale Schutz weitergeht als der humanitäre Schutz des AufenthG.
Nach neuer Rechtslage soll nun auch dann nicht mehr über Abschiebungsverbote entschieden werden, wenn diese in einem früheren Verfahren bereits abgelehnt wurden.
Das führte dazu, dass bei unzulässigen Asylfolgeanträgen über Abschiebungsverbote nicht mehr entschieden werden darf, auch wenn diese vorliegen. Es wäre zusätzlich die Feststellung der Abschiebungsverbote explizit zu beantragen.
a.
In der Praxis würden nicht-anwaltlich vertretene Antragsteller*innen kaum auf die Idee kommen, im Rahmen einer Folgeantragstellung explizit auch die Zuerkennung von Abschiebungsverboten zu beantragen, zumal die materiell-rechtliche Unterscheidung – insbesondere zwischen § 4 AsylG und § 60 Abs. 5 AufenthG – eine umfassende Kenntnis der europäischen und nationalen Rechtsprechung voraussetzt.
Die vorgeschlagene Änderung hätte im vergangenen Jahr 2021 bspw. folgende Auswirkung gehabt:
Für anwaltlich nicht vertretene Afghan*innen, deren Asylantrag schon früher abgelehnt worden war und die nach Machtübernahme der Taliban einen Folgeantrag stellten, konnte nach geltender Rechtslage ein Abschiebungsverbot festgestellt werden, ohne dass sie dies explizit beantragen mussten. Vielmehr brachten sie durch den Asylantrag zum Ausdruck, dass sie Schutz suchten vor den Gefahren und schweren Folgen einer Rückkehr nach Afghanistan.
Nach neuer Rechtslage wäre im Rahmen eines solchen Folgeantrags lediglich über die Flüchtlingseigenschaft und den subsidiären Schutz entschieden worden. Sieht das BAMF die Voraussetzungen dafür nicht gegeben, würden Abschiebungsverbote mangels Antrags nicht geprüft werden. Der Asylfolgeantrag der im obigen Beispiel genannten Personengruppe wäre abgelehnt.
Dem BAMF käme im Rahmen der geplanten Gesetzesänderung eine zusätzliche erhebliche Beratungspflicht zu, da § 25 Abs. 1 VwVfG vorsieht, dass die Behörde die Abgabe von Erklärungen, die Stellung von Anträgen oder die Berichtigung von Erklärungen oder Anträgen anregen soll, wenn diese offensichtlich nur versehentlich oder aus Unkenntnis unterblieben oder unrichtig abgegeben oder gestellt worden sind.
b.
Zudem entspricht die jetzt geltende Regelung bei Ablehnung eines Antrags, immer auch über das Vorliegen von Abschiebungsverboten zu entscheiden, den nationalen und europarechtlichen Vorgaben. Danach sind Abschiebungsverbote von Amts wegen in jeder Lage eines Verfahrens zu prüfen. Dies gebieten Inhalt und Bedeutung der Rechte der*s Antragstellerin*s aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, deren Verletzung droht – vorliegend Art. 3 EMRK – sowie aus dem Grundgesetz – insbesondere Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG. Schließlich steht auch Art. 19 Abs. 4 GG in Verbindung mit der drohenden Verletzung des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit der angedrohten Abschiebungsandrohung entgegen. Die Vorschrift des Art. 19 Abs. 4 GG statuiert ein echtes (subjektives) Grundrecht, das dem Einzelnen einen Anspruch auf Gewährung eines möglichst wirkungsvollen (effektiven) Rechtsschutzes verleiht. Insbesondere irreparable Folgen hoheitlicher Maßnahmen müssen durch einen tatsächlich wirksamen und möglichst lückenlosen Rechtsschutz so weit wie möglich vermieden werden. Ein lückenloser Rechtsschutz ist aber dann nicht mehr gegeben, wenn im Rahmen eines die Abschiebung zunächst hindernden Asylfolgeantrags Abschiebungsverbote nicht geprüft würden, auch wenn diese geltend gemacht werden. Das BAMF könnte ablehnen, die Ausländerbehörde, die an die Prüfung von zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten durch das BAMF gebunden wäre (§ 42 AsylG), könnte abschieben, ohne dass Abschiebungsverbote je geprüft werden.
An diesem unvertretbaren Ergebnis würde auch ein expliziter Antrag auf Feststellung von Abschiebungsverboten nichts ändern, der bereits nach jetziger Rechtslage gem. § 51 VwVfG möglich ist, allerdings keine die Abschiebung hindernde Wirkung hat. Im Übrigen dauert die Prüfung derartiger Anträge derzeit durchschnittlich deutlich länger als 6 Monate. Die Prüfung ist daher in vielen Fällen durch gerichtlichen Eilrechtsschutz abzusichern und führte zu einer weiteren Belastung der Verwaltungsgerichte.
c.
Eine Einbeziehung der Prüfung von Abschiebungsverboten dient letztlich auch der Verfahrensbeschleunigung, da spätestens bei der Frage der Vollziehbarkeit einer Rückführungsentscheidung, Abschiebungsverbote (die ja dem Aufenthaltsgesetz entstammen) zu prüfen wären.
d. Empfehlung
Die vorgeschlagene Änderung ist abzulehnen.
6. § 37 AsylG-E: Folge eines stattgebenden Eilrechtsschutzbeschlusses bei Unzulässigkeitsentscheidungen
Bisher ist ein Bescheid, der einen Asylantrag wegen der Zuerkennung von internationalem Schutz in einem anderen Mitgliedsstaat als unzulässig abgelehnt hat (sog. Drittstaatsbescheid), bei Stattgabe eines Eilrechtschutzantrags unwirksam. Diese Regelung soll nunmehr gestrichen werden. Laut Gesetzesbegründung ist das Ziel die Vermeidung von Endlosschleifen, die durch den erneuten Erlass eines Drittstaatsbescheids durch das BAMF ausgelöst werden sollen.
Die Streichung der Regelung führt aber – entgegen des proklamierten Gesetzeszwecks – zu einer deutlichen Verlängerung der Verfahren. Aus anwaltlicher Erfahrung werden den meisten Eilrechtschutzanträgen im Rahmen von Drittstaatsbescheiden aufgrund drohender Verletzungen von Art. 3 EMKR / Art. 4 GrCH stattgegeben. In diesen Fällen ist Deutschland nach der Rechtsprechung des EuGH ohnehin verpflichtet, ein neues Asylverfahren durchzuführen. Dies geschieht in der Regel auch, wenn ein Drittstaatsbescheid aufgrund der Stattgabe im Eilrechtsschutzverfahren unwirksam wird. Die gesetzliche Folge der Stattgabe im Eilrechtsschutzverfahren führt also in der Praxis zu einer Entlastung der Gerichte und einer Beschleunigung der Verfahren. Sie abzuschaffen, wäre kontraproduktiv.
7. § 73 AsylG-E: Widerruf und Rücknahme
a. Gegenwärtige Rechtslage
Die gegenwärtige Rechtslage sieht vor, dass eine fehlerhafte Anerkennung als Asylberechtigter oder der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft unter bestimmten Umständen – insbesondere erwähnt das Gesetz hier unrichtige Angaben oder das Verschweigen wesentlicher Tatsachen – zurückgenommen werden kann (§ 73 Abs. 2 AsylG).
Ein Widerruf kann erfolgen, wenn eine grundlegende Änderung der Verhältnisse im Herkunftsland erfolgt ist (§ 73 Abs. 1 AsylG). Spätestens nach Ablauf von drei Jahren nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den Asylantrag hat die zuständige Behörde nach § 73 Abs. 2a AsylG zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für eine Rücknahme oder einen Widerruf vorliegen.
Entsprechende Regelungen existieren für die Rücknahme und den Widerruf des subsidiären Schutzes (§ 73b AsylG) bzw. der Feststellung nationaler Abschiebungsverbote (§ 73c AsylG). Mitwirkungspflichten im laufenden Asylverfahren sind in § 15 AsylG umfassend geregelt, § 15a AsylG regelt die Auswertung von Datenträgern und § 16 AsylG die Sicherung, Feststellung und Überprüfung der Identität.
In der Praxis haben Überprüfungen in der Vergangenheit nur in sehr wenigen Fällen zu einem Widerruf geführt. In den Rücknahme- und Widerrufsverfahren, die im ersten Halbjahr 2018 eingeleitet und entschieden wurden, hatte der überprüfte Schutzstatus vielmehr in 99,3% der Fälle Bestand (BT-Drs. 19/38393). Auch bei der nachträglichen Überprüfung von Identitätsdokumenten Schutzberechtigter wurden nur 0,5% der eingesandten Dokumente als Fälschung identifiziert. Eine Reformierung ist daher dringend geboten: Um Kapazitäten beim BAMF zu schaffen – die an anderer Stelle gebraucht werden – und um vielen Betroffenen ein weiteres nervenaufreibendes Verfahren zu ersparen, das im Ergebnis nicht nötig ist.
b. Zum Referentenentwurf
Zunächst ist zu begrüßen, dass § 73a ff. eine Neuordnung und übersichtlichere Regelung vorschlagen und Tatbestände und Verfahren in jeweiligen Normen getrennt regeln. Zu begrüßen ist auch eine leichte Abkehr der gesetzgeberischen Fehlleistung aus dem Jahr 2018. Insbesondere ist daneben aus den genannten Gründen zu begrüßen, dass die – unionsrechtswidrige – Regelüberprüfung nach drei Jahren gestrichen werden soll.
Problematisch sind derweil einzelne folgende Punkte der Reformvorschläge:
Dies betrifft zum einen die Gründe, die gem. § 73 Abs. 1 AsylG-E zu einem Widerruf führen können und an dieser Stelle in Form von Regelbeispielen aufgeführt werden. Insbesondere kann und darf die Wiedererlangung der Staatsangehörigkeit (Nr. 2) nicht regelhaft zu einem Widerruf führen: Die Möglichkeit der Wiedererlangung der Staatsangehörigkeit ist oftmals Ausdruck des Bestehens administrativer Widersprüche oder widerstreitender Praktiken im Verfolgerstaat.
Ebenfalls abzulehnen sind die Verweise in § 73b AsylG-E auf die Mitwirkungspflichten in den § 15, 16 AsylG: Mitwirkungspflichten sind nach Anerkennung bzw. Zuerkennung eines Schutzstatus grundsätzlich abzulehnen. Hier bedürfte es einer spezifischen Regelung, die der bereits ausgesprochenen Schutzbedürftigkeit Rechnung trägt. Das Unionsrecht sieht Mitwirkungspflichten z.B. in Art. 4 Abs. 1 der QualifikationsRL vor, allerdings in äußerst engen Grenzen. Soweit es um die Aberkennung, Beendigung oder Ablehnung der Verlängerung des Schutzstatus im Unionsrecht geht, ist dies in Art. 14 Abs. 1 und 19 Abs. 4 der QualifikationsRL geregelt. Auch hier ist bereits normiert, dass im Falle einer falschen Darstellung oder des Verschweigens eine Aberkennung des Schutzstatus erfolgen kann (Art. 19 abs. 3 (b) QualifikationsRL). Das Unionsrecht sieht dabei eindeutig vor, dass die Mitgliedstaaten die entsprechenden Voraussetzungen nachzuweisen haben. Art. 44 der AsylverfahrensRL sieht – ohne zwischen Rücknahme und Widerruf zu differenzieren – eine Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft bei neuen Erkenntnissen vor. Die anlasslose automatisierte und verpflichtende Regelprüfung im deutschen Recht ist dem Europarecht fremd.
Für die vorliegend interessierende Konstellation des Widerrufs und der Rücknahme ist Art. 11 Abs. 1 e) und Art. 19 Abs.3 b) und Abs.4 der QualifikationsRL zu beachten. Voraussetzung eines Widerrufs nach 11 Abs. 1 e) QualifikationsRL ist ein Wegfall der Umstände, aufgrund derer eine Person einen Schutzstatus erhalten hat, wobei der Nachweis hierzu von den Mitgliedstaaten gemäß 11 Abs. 2 QualifikationsRL zu führen ist.
Die Aberkennung eines Schutzstatus kann nach Unionsrecht außerdem erfolgen, wenn für die Zuerkennung des Schutzstatus eine falsche Darstellung oder das Verschweigen von Tatsachen, einschließlich der Verwendung falscher oder gefälschter Dokumente ausschlaggebend war. Art. 19 Absatz 4 der QualifikationsRL stellt fest, dass ein entsprechender Nachweis durch die Mitgliedstaaten zu führen ist.
Festzuhalten ist somit, dass sowohl für die Konstellation des Widerrufs als auch für die Konstellation der Rücknahme das Unionsrecht die Beweislast auf Seiten der Mitgliedstaaten verortet und nicht an Handlungen der Betroffenen anknüpft. Ein Widerruf bzw. eine Rücknahme im Rahmen einer Wertung als faktische Sanktion nicht erfolgter Mitwirkung ist unionsrechtswidrig.
Problematisch und zugleich nicht nötig ist § 73b Abs. 4 AsylG-E: Demnach soll im Rahmen eines Einbürgerungsverfahrens die Verbindlichkeit der Entscheidung über den Asylantrag bis zur Bestandskraft des Widerrufs oder der Rücknahme entfallen. Dies ist abzulehnen. Es besteht auch keine Regelungsnotwendigkeit, da die Aufenthaltserlaubnis selbst bei erfolgtem Widerruf/Rücknahme nicht automatisch entfällt und somit auch in aller Regel weiter ein Rechtsanspruch auf Einbürgerung bestehen wird.
Schließlich ist die Monatsfrist zur Stellungnahme in § 73b Abs.6 AsylG-E praktisch zu kurz bemessen. Das gilt insbesondere für den Fall, dass neue Unterlagen vorgelegt werden sollen. Die Frist ist regelhaft auf drei Monate zu setzen.
c. Empfehlung
§ 73 AsylG-E Abs 1 Nr. 1 bis 4 und 6 ist zu streichen
§ 73b AsylG Abs. 2 ist um den Widerruf und die Rücknahme des subsidiären Schutzes zu ergänzen.
§ 73b Abs. 4 AsylG-E ist zu streichen
§ 73b Abs. 5 AsylG-E ist dahingehend zu ändern, dass der Verweis auf die Mitwirkungspflichten teilweise gestrichen, und die Beweislast des BAMF deutlich geregelt wird.
§ 73 b Abs. 6 AsylG-E ist dahingehend zu ändern, dass die Frist auf 3 Monate gesetzt wird.
8. § 74 AsylG-E: Befangenheit von Richter*innen
a. Reformentwurf und Bewertung
Bislang führt ein Ablehnungsgesuch gem. § 54 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 47 Abs. 1 ZPO dazu, dass die/der abgelehnte Richter*in vor Erledigung des Ablehnungsgesuchs nur noch unaufschiebbare Handlungen vornehmen darf. Eine Ausnahme davon bildet § 54 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 47 Abs. 2 ZPO. Demgemäß führt eine Ablehnung wegen Befangenheit nach Beginn der mündlichen Verhandlung schon dann nicht zu einem Tätigkeitsverbot der*des Richters*in in der Sache, wenn dies zu einer Terminvertagung führen würde. Eine zeitliche Verzögerung durch einen in der mündlichen Verhandlung gestellten Befangenheitsantrag ist daher bereits durch die geltende Rechtslage ausgeschlossen.
b. Regelungsvorschlag
Die nunmehr vorgeschlagene Regelung erweitert den Ausnahmezeitraum des § 47 Abs. 2 ZPO auf drei Tage vor den Beginn der mündlichen Verhandlung. Wenn in diesem Fall die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch zu einer Vertagung der Verhandlung führt, so kann die mündliche Verhandlung auch unter Mitwirkung des abgelehnten Richters erfolgen.
c. Kommentierung
Diese Erweiterung ist nicht nachvollziehbar. Über das Ablehnungsgesuch entscheidet die Kammer, der die/der Einzelrichter*in angehört. Wieso eine Kammerentscheidung auch drei Tage vor dem Beginn der mündlichen Verhandlung nicht möglich sein sollte, ist nicht nachvollziehbar. Selbst am Tag der mündlichen Verhandlung oder kurz davor ist nicht ersichtlich, weshalb die Kammer nicht über ein Ablehnungsgesuch entscheiden könnte. Die Kammer ist gem. § 45 Abs. 3 ZPO solange beschlussfähig, solange noch ein anderes Mitglied als der oder die abgelehnte Richter*in anwesend ist. Als beschlussfähige Mitglieder gelten auch die Richter*innen, die im Geschäftsverteilungsplan als ersatzzuständig vorgesehen sind, so dass eine Nichtbesetzung der Kammer fast ausgeschlossen ist.
Nur in dem unwahrscheinlichen Fall, dass kein Kammermitglied anwesend ist, muss das nächsthöhere Gericht entscheiden. Die Regelung sieht aber vor, dass die Entscheidung über die Ablehnung zu einer Vertagung der Verhandlung führen muss. Wie dargelegt, ist dieser Fall extrem unwahrscheinlich, so dass die Regelung ins Leere geht und daher nicht erforderlich ist.
Die Länge der Frist ist im Gesetzesentwurf und seiner Begründung auch nicht näher erläutert und erscheint willkürlich gezogen. In der Praxis gibt es ohnehin bis kurz vor der mündlichen Verhandlung keine Handlungen der*/des zuständigen Einzelrichter*in, die eine Befangenheit begründen könnte. PKH-Anträge werden oft erst kurz vor der mündlichen Verhandlung entschieden und weitere Äußerungen erfolgen oft gar nicht. Somit würde die Ausweitung der Frist dazu führen, dass selbst bei offensichtlichem Vorliegen der Befangenheit mit dem*/der befangenen Richter*in verhandelt werden müsste. Dazu ist bereits geregelt, dass ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Befangenheitsantrag nicht zum Ausschluss der*/des Richter*in führen muss.
Die jetzige Rechtslage regelt bereits eine weitgehende Ausnahme vom Tätigkeitsverbot des/der* abgelehnten Richters*in, so dass eine Erweiterung des prozessualen Sonderrechts nicht gerechtfertigt und damit abzulehnen ist. Das Verfahrensrecht und die darin niedergelegten Garantien sollen eine Waffengleichheit zwischen den Kläger*innen und dem Gericht ermöglichen, die dem besonderen Prozessverhältnis geschuldet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Gericht den Kläger*innen dient und nicht umgekehrt. Diese Verfahrensgarantien würden durch die vorgeschlagene Änderung noch weiter ausgehöhlt werden. Zu beachten ist auch, dass in anderen Rechtsgebieten (vgl. § 25 StPO) die Ausnahmen vom Tätigkeitsverbot nach Ablehnung an den Beginn der mündlichen Verhandlung geknüpft sind, weil dies prozessökonomisch zu rechtfertigen ist. Eine weitere Ausdehnung ist hingegen nicht mehr zu rechtfertigen, insbesondere mit Blick auf das grundrechtlich geschützte Recht auf den gesetzlichen Richter, Art. 101 Abs. 2 S. 1 GG.
d. Empfehlung
§ 74 AsylG-E ist abzulehnen.
9. § 77 AsylG-E: Schriftliches Verfahren
a. Reformentwurf und Bewertung
Bislang gibt es hierzu keine asylrechtliche Spezialregelung. Eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren kann auf Grundlage der Normen der VwGO (§ 101 Abs. 2 VwGO) nur mit Einverständnis aller Beteiligten erfolgen.
aa. Schriftliches Verfahren
Der Regelungsvorschlag sieht vor, dass in allen Fällen bei Klagen gegen Entscheidungen nach dem AsylG im schriftlichen Verfahren entschieden werden kann, wenn die*der Betroffene anwaltlich vertreten ist. Eine Ausnahme gilt nur für § 38 Abs. 1 AsylG (einfach unbegründet abgelehnte Asylanträge) und § 73b Abs. 7 AsylG (Neue Fassung, Widerruf oder Rücknahme einer bestehenden internationalen Schutzzuerkennung). Auf Antrag muss eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden, worauf die Beteiligten hinzuweisen sind. Die Regelung soll laut Gesetzesbegründung der Verfahrenserleichterung dienen und nur sachliche und tatsächlich einfach gelagerte Klageverfahren von nicht schwerwiegender Tragweite betreffen. Dabei sollen nur solche Verfahren betroffen sein, in denen die Schutzberechtigung nicht zur Disposition steht, was durch die Ausnahmeregelungen sichergestellt sein soll.
Zunächst geht die Begründung des Entwurfs in mehreren Annahmen fehl. Zum einen steht nicht nur bei Entscheidungen gem. § 38 Abs. 1 AsylG und § 73b Abs. 7 AsylG (neue Fassung) die Schutzberechtigung zur Disposition. Dies ist vielmehr auch dann der Fall, wenn ein Asylantrag als unzulässig gem. § 29 AsylG oder als offensichtlich unbegründet gem. § 30 AsylG abgelehnt wurde.
Zum anderen liegt diesen Fälle oft eine besonders schwierige rechtliche und tatsächliche Lage zugrunde. Die qualifizierte Ablehnung im Fall des § 30 AsylG ist an hohe Hürden geknüpft, was dazu führt, dass die tatsächlichen Ausführungen des BAMF besonders umfangreich sein müssen. Dies gilt auch für Entscheidungen gem. § 29 AsylG. Hier kommt hinzu, dass die rechtliche Lage sich oft als äußert komplex darstellt, was allein die zahlreichen Vorlagen an den EuGH in den letzten Jahren beweisen.
Oft zeigt sich auch in diesen Verfahren, dass eine mündliche Verhandlung zu einem anderen Ergebnis führt und die Entscheidungen des BAMF aufgehoben werden. Weiterhin sind die Folgen einer qualifizierten Ablehnung deutlich weiterreichend (vgl. § 10 AufenthG, Arbeitsverbot, etc.), so dass hier nicht nur die Schutzberechtigung, sondern noch weitere Rechtsgüter betroffen sind. Hier auf eine mündliche Verhandlung zu verzichten, würde die Betroffenen unangemessen benachteiligen und ist nicht zu rechtfertigen.
Weiterhin ist es den Gerichten bereits jetzt gem. § 84 Abs. 1 VwGO möglich, ohne mündliche Verhandlung per Gerichtsbescheid zu entscheiden, wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Natur aufweist und der Sachverhalt geklärt ist. Laut Gesetzesbegründung des Entwurfs sollen aber ohnehin nur sachlich und tatsächlich einfach gelagerte Klageverfahren von der Neuregelung umfasst sein. Diese sind aber bereits von § 84 Abs. 1 und § 101 VwGO erfasst. Eine asylrechtliche Sonderregelung ist daher nicht nötig.
Weiterhin ist der Entwurf viel zu unbestimmt. Es ist nicht klar, wann ein Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung gestellt werden soll. Diese Unklarheit kann zum Verlust von Verfahrensrechten oder neuen, viel längeren Verfahren führen.
Schließlich ist auch nicht ersichtlich, warum die bisherigen Regelungen nicht ausreichen. Grundsätzlich ist bei aufgeklärtem Sachverhalt und einer einfachen Sach- und Rechtslage nicht ersichtlich, warum eine anwaltlich beratene Asylbewerber*in nicht einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren zustimmen sollte, wenn es sachdienlich erscheint. Die Umkehr dieser Dispositionsmöglichkeit über das Stattfinden der mündlichen Verhandlung ist mit den Verfahrensgarantien des Art. 103 Abs. 1 GG nicht vereinbar. Dies gilt insbesondere im Asylverfahren, da die Glaubhaftigkeit des klägerischen Sachvortrags und die Glaubwürdigkeit der Kläger*innen aufgrund des Mangels an Beweismitteln fast ausschließlich in der mündlichen Verhandlung bewertet werden können und dieser daher besondere Bedeutung zukommt (vgl. BVerfG, Urteil vom 14. Mai 1996 – Az. 2 BvR 1516/93, Rn. 124). Dies liegt auch an einer mangelhaften und pauschalen Sachverhaltsaufklärung durch das BAMF.
Die Änderung sollte gestrichen werden.
bb. Einbeziehung neuer Entscheidungen
Bisher gibt es keine Regelung, die zu einer Einbeziehung einer neuen Entscheidung im laufenden Asylklageverfahren führt. Es gilt die Dispositionsmaxime. Der oder die Kläger*in entscheidet selbst, ob und in welchem Umfang gegen eine Entscheidung der Verwaltung Klage erhoben wird. Dies findet seinen Niederschlag in § 81 VwGO und § 82 VwGO, die regeln, dass ein/eine Kläger*in selbst Klage erheben muss und bestimmen kann, wogegen und in welchem Umfang geklagt wird. Weiterhin regelt § 88 VwGO, dass das Gericht nicht über das Klagebegehren hinausgehen kann und an die Fassung der Anträge gebunden ist.
Die Regelung sieht vor, dass ein im laufenden Klageverfahren erlassener neuer Bescheid des BAMF, der den Asylantrag als einfach oder offensichtlich unbegründet ablehnt, automatisch Gegenstand des Verfahrens wird. Voraussetzung ist, dass sich das ursprüngliche Klageverfahren gegen die Ablehnung eines Asylantrags als unzulässig gerichtet hat. Begründet wird dies mit einer Beschleunigung der Verfahren. Insbesondere wird auf die Konstellation abgezielt, in der ein Dublin-Verfahren eingeleitet wurde und der ablehnende Bescheid aufgrund des Ablaufs der sechsmonatigen Überstellungsfrist im laufenden Klageverfahren rechtswidrig wird. Hier soll das BAMF im laufenden Klageverfahren eine materielle Prüfung durchführen können. Der ablehnende Bescheid wird dann automatisch Bestandteil der Klage.
Die Regelung ist äußerst problematisch und verstößt gegen fundamentale Rechtsprinzipien der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Dispositionsmaxime sieht vor, dass Kläger*innen selbst durch einen klageeinleitenden Akt darüber bestimmen können, ob und im welchem Umfang ein Rechtsakt angegriffen wird (oder der Erlass eines solchen begehrt wird). Er findet seinen Ausfluss in § 81 VwGO, der den Beginn des Gerichtsprozesses von der förmlichen Einleitung der Klage abhängig macht, in § 82 VwGO, der es dem oder der Kläger*in vorschreibt, den Umfang ihres Klagebegehrens zu bezeichnen, in § 88 VwGO, der das Gericht in seiner Entscheidung an das Klagebegehren bindet und in § 92 VwGo, der es den Kläger*innen erlaubt, eine Klage wieder zurückzunehmen (vgl. Kopp/Schenke § 119, Rn. 4; Sodan/Ziekow, § 88, Rn. 1). Die automatische Einbeziehung einer neuen und völlig anderen Verwaltungsentscheidung in ein Klageverfahren würde ganz grundsätzlich gegen die Dispositionsmaxime verstoßen. Eine ausreichende Rechtfertigung hierfür ist nicht ersichtlich.
Auch ist das erklärte Ziel, die Beschleunigung der Verfahren, nicht gewährleistet. Durch die automatische Einbeziehung des ablehnenden Gerichtsbescheids wird das Gerichtsverfahren nicht beendet, sondern automatisch verlängert. Zahlreiche Klageverfahren werden nicht geführt, weil die Betroffenen gegen negative (materielle) Entscheidungen des BAMF nicht klagen. Gegen alle negativen Bescheide, die im Anschluss an eine Ablehnung als unzulässig erlassen werden, wird nun automatisch ein Klageverfahren geführt, ob die Betroffenen das wollen oder nicht. Dies schließt im Übrigen auch solche Verfahren mit ein, in denen Abschiebungsverbote gewährt werden. Die (unfreiwilligen) Kläger*innen können dann auch keine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 3 AufenthG erhalten, weil diese während des laufenden Asylklageverfahrens gem. § 10 Abs. 1 AufenthG gesperrt ist. Die Regelung erscheint angesichts der automatisch eintretenden und nachteiligen Folgen für Betroffene und Gerichtsbarkeit geradezu absurd.
Ob die nun eingefügte Regelung, nach der die Beklagte Bundesrepublik Deutschland stets die Kosten in einem solchen Verfahrensverlauf bei Rücknahme zu tragen hat, im Sinne der Steuerzahler*in ist, wird an dieser Stelle nicht weiter beurteilt. Weiterhin wird auch die pauschale Kostentragung des BAMF bei unverzüglicher Rücknahme der Klage nach Einbeziehung des neuen Verwaltungsakts zu unabsehbaren Kosten für das BAMF führen. Bislang lehnt ein Großteil der Gerichte die Kostentragungspflicht des BAMF bei Erledigung eines Klageverfahrens gegen einen Dublin-Bescheid wegen Ablaufs der Überstellungsfrist ab. Die pauschale Kostenregelung geht daher zu Lasten des BAMF. Dies müsste auch dann gelten, wenn ein zweites Verfahren gegen den ablehnenden materiellen Asylbescheid anhängig gemacht wird und die Klage gegen den ersten Bescheid zurückgenommen wird. Ob sich der Streitwert nicht auch automatisch durch Erweiterung des Streitgegenstands erhöht und damit noch höhere Kosten für das BAMF verursacht, bleibt unklar.
Darüber hinaus setzt eine Entscheidung über die Begründetheit des Asylantrags auch voraus, dass eine entsprechende Anhörung stattgefunden hat. Eine solche Anhörung muss entsprechend den Vorschriften der Richtlinie 2013/32/EU erfolgen. Sie kann nicht in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung nachgeholt werden, weil dies den Anforderungen an Vertraulichkeit der Anhörung widerspricht (vgl. BVerwG 1 C 41.20 - Urteil vom 30. März 2021). Das heißt, dass das BAMF selbst in Fällen, in denen die Bundesrepublik Deutschland für die Prüfung des Asylantrags zunächst nicht zuständig ist, immer auch eine Anhörung zu den materiellen Asylgründen durchführen muss, damit ein ablehnender Bescheid nach Ablauf der Überstellungsfrist im laufenden Klageverfahren ergehen kann. Dies erfordert einen zusätzlichen Zeitaufwand von rund 3 Stunden pro Antragsteller*in, da die Anhörung zu den materiellen Asylgründen in der Regel deutlich länger dauert, als die zur Zulässigkeit des Asylantrags. Die Regelung würde also zu einer deutlichen Mehrarbeit des BAMF führen und nicht zu einer Beschleunigung des Asylverfahrens.
Weiterhin stellt sich die Frage, was geschieht, wenn sich die Sachlage nach Erlass der Dublin-Entscheidung geändert hat, was bei zahlreichen Herkunftsländern der Fall ist. In diesem Fall müsste möglicherweise erneut eine Anhörung stattfinden, um eine ordnungsgemäße Entscheidung zu treffen. Das würde den Prozess noch mehr verlangsamen.
Die Regelung ist also nicht nur ein massiver und ungerechtfertigter Eingriff in die Verfahrensrechte der Betroffenen. Sie wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer höheren Belastung für die Gerichte und das BAMF führen und damit das Verfahren noch weiter verlangsamen.
Die Regelung sollte gestrichen werden.
Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Verfahrensbeteiligten, dass sie Gelegenheit erhalten, sich vor Erlass einer gerichtlichen Entscheidung zu dem diesem zugrundeliegenden Sachverhalt zu äußern und dadurch die Willensbildung des Gerichts zu beeinflussen.
Aus Art. 103 Abs. 1 GG (vgl. Art. 6 Abs. 1 EMRK) folgt nicht unmittelbar ein Anspruch auf eine mündliche Verhandlung (vgl. BVerfGE 5, 9 <11>; 21, 73 <77>; 36, 85 <87>; 60, 175 <210>; 89, 381 <391>; 112, 185 <206>). Es ist vielmehr Sache des Gesetzgebers, zu entscheiden, in welcher Weise das rechtliche Gehör gewährt werden soll (vgl. BVerfGE 9, 89 <95 f.>; 60, 175 <210 f.>; 67, 208 <211>; 74, 1 <5>; 89, 381 <391>) (- 1 BvR 367/15 - ).
b. Empfehlung
Der Vorschlag ist als Ganzes abzulehnen.
10. § 78 AsylG-E: Rechtsmittel
a. Bisherige Rechtslage
§ 78 AsylG bestimmt bisher im Wesentlichen, wann ein Urteil des Verwaltungsgerichts unanfechtbar ist und aus welchen Gründen die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts zuzulassen ist. Es handelt sich um ein gegenüber der VwGO einschränkendes Sonderprozessrecht im Asylverfahren. Denn in § 78 Abs. 3 AsylG sind für das Asylrecht die Gründe für die Zulassung der Berufung gegenüber der allgemeineren Regelung des § 124 VwGO stark eingeschränkt.
b. Gesetzesentwurf und Bewertung
Die vorgeschlagene Änderung durch Einfügung des § 78 Abs. 8 AsylG führt eine spezielle »Tatsachenrevision« ein und beschränkt zugleich die Revisionsmöglichkeiten für Betroffene.
Ziel der Neuregelung ist die Beschleunigung der Gerichtsverfahren und Vereinheitlichung der Rechtsprechung in Asylsachen. Eine bundesweit einheitliche Rechtsprechung zu asyl- und abschiebungsrelevanten Fragen soll laut der Begründung des Entwurfs Schutzsuchenden ermöglichen, frühzeitig die Erfolgsaussichten einer Klage zu bewerten und auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu treffen. Auf diese Weise könnten im Ergebnis ›erfolglose‹ Klagen verringert werden, die Gerichte würden entlastet.
Diese Erwartung ist aus unserer Sicht unbegründet. Zum einen geben nicht selten geringfügig abweichende Einzelumstände Grund für eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung. Eine Leitentscheidung für eine Vielzahl an Sachverhalten kann so kaum getroffen werden. Zum anderen bleibt unklar, in welcher Weise neue Entwicklungen im Herkunftsland in Abweichung von den Leitentscheidungen berücksichtigt werden können. Dies ist aber nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bei einer volatilen Sicherheitslage tagesgenau erforderlich. In der Folge wird es statt zu Klarheit und Einheitlichkeit zu Unklarheit und Streit kommen.
Statt einer Entlastung der Gerichte ist daher eine erhöhte Belastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, insbesondere des Bundesverwaltungsgerichts, zu erwarten. Stellt man sich die Frage, wie das Asylverfahren für Schutzsuchende fairer gestaltet werden kann, so kann dies vor allem über eine Verbesserung der Rechtsschutzmöglichkeiten erreicht werden, nicht über deren Verkürzung.
c. Empfehlungen
Die vorgeschlagene Änderung ist abzulehnen.
Um die Verfahren fairer und einheitlicher zu gestalten, empfehlen wir stattdessen, die Zulassungsgründe zu erweitern. Nach allgemeiner Rechtsauffassung sind EuGH und EGMR nicht divergenzfähig im Sinne von § 78 Abs. 3 Nr. 2 AsylG (vgl. z.B. BayVGH, B. vom 09. April 2018, 11 ZB 18.30631, Rn. 2, zit.n.juris). Divergenzfähig wird eine Entscheidung des EuGH danach erst durch eine konkrete Übernahme des BVerfG im Einzelfall.
Das gilt zwar auch bei § 124 VwGO (und ist auch dort eigentlich nicht gerechtfertigt), richtet dort aber wegen der ansonsten erheblich weiter gefassten Zulassungsgründe nicht so großen Schaden an. Im Zweifel bestehen bei einer Abweichung von einer Entscheidung des EuGH auch »ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils« § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO. Diesen Zulassungsgrund gibt es aber bei § 78 AsylG gerade nicht.
Besonders fatal ist dies, weil gerade im Asylrecht Entscheidungen des EuGH große Bedeutung haben, z.B. dessen Urteil vom 07. November 2013, C-199/12 bis C-201/12. Dieses wurde erst Jahre später durch den Beschluss des BVerfG vom 22. Januar 2020, 2 BvR 1807/19, zur verfassungsrechtlichen Rechtsprechung übernommen und dadurch divergenzfähig. Eine Klarstellung, dass auch Entscheidungen des EuGH und des EGMR divergenzfähig sind, würde hier eine Klarstellung bewirken und die bisher bestehende Lücke schließen.
11. § 79 Besondere Vorschriften für das Berufungsverfahren
a. Reformentwurf und Bewertung
Die vorgeschlagene Änderung soll das bisher geltende Zurückverweisungsverbot lockern. Dies soll eine Entlastung bei den Oberverwaltungsgerichten erzielen.
Nach der bisherigen Rechtslage ist das Oberverwaltungsgericht verpflichtet, nach einer Zulassung der Berufung die Verfahren auch dann entscheidungsreif zu machen, wenn es die allgemeine asyl-, abschiebungs- oder überstellungsrelevante Lage in einem Zielstaat anders als das Verwaltungsgericht beurteilt und die Schutzgewährung durch das Verwaltungsgericht wesentlich von dieser Beurteilung abhing. Dies soll sich nun ändern und das bisher geltende absolute Zurückweisungsverbot soll teilweise gelockert werden. Die Oberverwaltungsgerichte erhalten in bestimmten Fällen nun die Möglichkeit, Verfahren an die erstinstanzlichen Gerichte zurückzuverweisen.
Die Änderung geht aus unserer Sicht nicht weit genug. Statt das Zurückweisungsverbot ganz aufzuheben, wird es eingeschränkt.
Das Zurückweisungsverbot ist jedoch als Ganzes abzulehnen, denn es verkürzt die Rechtsschutzmöglichkeiten der Betroffenen, indem es den in der VwGO vorgesehenen Instanzenzug verkürzt.
b. Empfehlung
Die vorgeschlagene Regelung ist abzulehnen und Abs. 2 stattdessen komplett zu streichen.
III. SONSTIGE REFORMVORSCHLÄGE
§ 3 Abs. 3 AsylG Ausschluss
Die Norm ist tatsächlich nicht praktikabel und hätte in der Praxis kaum Anwendungsfälle und ist daher abzulehnen. Die Regelung der Asylunwürdigkeit besteht bereits.
§ 5 Abs. 6 AsylG-E
Eine Sicherheitsprüfung sollte in allen Fällen zwingend erfolgen.
§ 33 ASylG-E
Die Regelung, zumal ohne ausdrückliche Belehrung über die Rechtsfolgen des Nicht-Betreibens, ist abzulehnen.
§ 72 AsylG-E
Es ist zu begrüßen, dass die in § 72 Abs. 1 Nr. 1-3 AsylG genannten Gründe nun nicht mehr zum Erlöschen des Schutzstatus führen sollen, sondern in einem Verfahren nach § 73 AsylG-E zu prüfen sind. Es ist dagegen abzulehnen, dass eine Verzichtserklärung zur Durchführung des Asylverfahrens von der Ausländerbehörde an das Bundesamt weiterzuleiten ist. In der Praxis gibt es mit solchen Erklärungen gegenüber der Ausländerbehörde regelmäßig Probleme, da den Betroffenen nicht klar ist, auf was sie verzichten. In der Praxis sollte vielmehr vor Erteilung eines Aufenthaltstitels geprüft und qua Schreiben auch mitgeteilt werden, dass der Erteilung eines Aufenthaltstitels bei im Übrigen gleichbleibenden Verhältnissen nur noch die Rücknahme des Asylantrags entgegensteht. Der Verzicht kann rechtsgültig nur gegenüber dem Bundesamt erklärt werden.
Berlin, den 24. November 2022
Die Stellungnahme als PDF